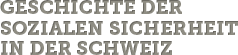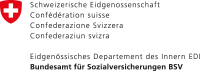Unternavigation
Familie, Mutter- und Vaterschaft
Bis ins 19. Jahrhundert gelten Mutterschaft und Familie als natürliche Risiken, die keiner sozialstaatlichen Absicherung bedürfen. Dies ändert sich nach dem Ersten Weltkrieg, als die Mutterschaftsversicherung und Familienzulagen auf die politische Agenda gesetzt werden. 1945 verankert der Souverän beide Instrumente in der Bundesverfassung. Die Umsetzung zieht sich jedoch in die Länge. Während im Fall der Familienzulagen vorerst die Kantone in die Lücke springen, verzögert sich die Realisierung der Mutterschaftsversicherung bis 2004.
Bereits im 19. Jahrhundert galten Ehe und Familie als Inbegriff der Privatsphäre. Vor allem die Rechte des Ehemannes, unter dessen Vormundschaft sich Ehefrau und Kinder befanden, sollten dabei vor staatlichen Eingriffen geschützt werden. Davon ausgenommen waren Kinder, deren Eltern verstarben oder angeblich nicht in der Lage waren, für sie zu sorgen. Seit dem 16. Jahrhundert entwickelte sich schrittweise ein öffentliches Vormundschaftswesen, das 2013 zum Kinder- und Erwachsenenschutzrecht erweitert wurde. Gleichzeitig bildeten die Geburt, Pflege und Erziehung von Kindern die Voraussetzung dafür, dass sich Gesellschaften über mehrere Generationen hinweg erhalten können. Bereits früh drängten sich deshalb sozialstaatlich bedeutsame Fragen auf: Sind Gebären und Familie wirklich Privatsache oder soll die Gesellschaft als Ganzes zur Absicherung der finanziellen Risiken und Belastungen beitragen, die mit der Mutterschaft und der Gründung einer Familie verbunden sind? An welchen Familien- und Geschlechterverhältnissen soll sich der Staat im Falle sozialstaatlicher Massnahmen orientieren? Im Gegensatz zum Alters- und Krankheitsrisiko, deren sozialer Charakter schon im 19. Jahrhundert anerkannt war, blieb die gesellschaftliche Verantwortung für die scheinbar natürlichen Risiken Geburt und Familie bis weit ins 20. Jahrhundert hinein umstritten. Die damit verbundenen Lasten in Form von unbezahlter Arbeit oder Erwerbseinbussen werden bis heute grösstenteils von Frauen getragen. Zugleich orientierten sich die familienorientierten Massnahmen in der Sozialhilfe und im Vormundschaftswesen seit dem 19. Jahrhundert an einem bürgerlichen Familienmodell, das auch für die Unterschichten gelten sollte.
Arbeiterinnenschutz und Anläufe für eine Mutterschaftsversicherung
Wie die Kinderarbeit gehörte die Mutterschaft zu den ersten Bereichen, in denen der moderne Sozialstaat tätig war. Der Schutz der Gesundheit von schwangeren Frauen und jungen Müttern stand zunächst im Vordergrund. Das Eidgenössische Fabrikgesetz von 1877 schrieb für Mütter eine Ruhezeit von acht Wochen vor, wovon sechs in die Zeit nach der Geburt fallen mussten. Weiter konnte der Bundesrat Fabrikationszweige bezeichnen, die keine schwangeren Frauen beschäftigen durften. Hinzu kamen Schutzbestimmungen wie ein Verbot für Sonntags- und Nachtarbeit, das alle Frauen betraf und diese zu einer Sonderkategorie auf dem Arbeitsmarkt machte. Eine Regelung des Erwerbsausfalls enthielt das Gesetz dagegen nicht, wodurch es in den Augen der Geschützten zweischneidig blieb. Tatsächlich blieb es den betroffenen Frauen und Familien überlassen, wie sie für den Unterhalt ihres Neugeborenen aufkommen sollten. Eine gewisse Erleichterung brachte erst das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG) von 1911, gemäss dem versicherte Wöchnerinnen während sechs Monaten die gleichen Leistungen wie im Krankheitsfall zugute hatten. Je nach Versicherung umfassten die Leistungen Krankenpflege oder auch ein Krankengeld. Allerdings war zu dieser Zeit nur ein kleiner Teil der Frauen überhaupt krankenversichert, so dass breite Kreise von der Verbesserung gar nicht profitierten.
Der Arbeiterinnenschutz war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur in der Schweiz Gegenstand sozialpolitischer Debatten. In Deutschland wurde 1878 der gesetzliche Schwangerenschutz eingeführt. Ursprünglich beschränkten sich die Bestimmungen auf einen überschaubaren Kreis von Frauen und sahen bloss ein dreiwöchiges Arbeitsverbot vor. Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 gewährte zusätzlich ein Wochengeld für versicherte Wöchnerinnen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Anspruch auf alle Frauen ausgedehnt, deren Angehörige bei einer Krankenkasse versichert waren. In Frankreich galt seit 1909 eine Arbeitsplatzgarantie, wenn die Mütter in den Wochen vor und nach der Geburt nicht zur Arbeit erscheinen konnten. Zudem wurden 1913 Beihilfen für erwerbstätige Frauen eingeführt.
Damit der finanzielle Schutz in der Schweiz nicht nur wenigen Frauen zugesichert blieb, forderten Arbeiterinnen und Teile der bürgerlichen Frauenbewegung bereits früh eine Mutterschaftsversicherung. 1904 lancierten sie erstmals eine Petition an den Bundesrat, die allerdings folgenlos blieb. Im Zeichen des sogenannten sozialpolitischen Aufbruchs nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnete die Schweiz dann 1919 die Beschlüsse der Internationalen Arbeitskonferenz von Washington, die unter anderem vorsahen, dass schwangere Frauen und Wöchnerinnen, während bis zu 12 Wochen Anrecht auf finanzielle Unterstützung erhielten. Die Ratifikation der Übereinkunft kam jedoch rasch ins Stocken. Im Herbst 1921 lehnte das Parlament einen Beitritt zum Abkommen endgültig ab. Die Gegner störten sich vor allem an den Kosten der vorgeschlagenen Versicherung. Bürgerliche Politiker, allesamt Männer, begründeten ihre Ablehnung auch damit, dass es sich bei der Geburt um einen natürlichen Vorgang handle, der keines besonderen sozialen Schutzes bedürfe. Nach dem Veto der Räte liess der Bundesrat in einem zweiten Schritt eine Revision des KUVG prüfen. Auch dieser Anlauf scheiterte 1923, wobei vor allem Vorbehalte gegenüber einem (Teil-)Obligatorium in der Krankenversicherung den Ausschlag gaben.
In den Folgejahren absorbierte die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) die politische Aufmerksamkeit. Erneute Vorstösse – etwa zur Einführung einer nur von erwerbstätigen Frauen finanzierten Wöchnerinnenversicherung – versandeten Ende der 1930er-Jahre. Erst unter dem Eindruck des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels und im Schlepptau der Familienschutzinitiative der Katholisch-Konservativen gelang es Exponenten der Sozialdemokraten und der bürgerlichen Parteien, gemeinsam mit der Frauenbewegung 1945 die Verfassungsgrundlage für eine Mutterschaftsversicherung durchzubringen.
Familienpolitik im Zeichen des Familienschutzes
Im 19. Jahrhundert intervenierten staatliche Behörden vor allem aus armenrechtlichen Gründen in Familien, etwa wenn Eltern oder Elternteile wegen Armut in Armenhäuser überwiesen und ihre Kinder in Heime oder Pflegefamilien platziert wurden. Das Zivilgesetzbuch (ZGB) von 1912 schuf auf nationaler Ebene einheitliche Regeln für behördliche Interventionen in Familien, die sich neu am Kindswohl ausrichteten. In Fällen von «Verwahrlosung» - ein zentraler Begriff des Kinderschutzes im ZGB – waren kommunale oder kantonale Vormundschaftsbehörden ermächtigt, die Eltern präventiv zu bevormunden und deren Kinder fremd zu platzieren. Verschiedene Kantone und Städte errichteten in den folgenden Jahrzehnten spezialisierte Behörden neben den Vormundschaftsbehörden, so etwa staatliche Jugendämter.
In der Zwischenkriegszeit verdichteten sich die Debatten über die Frage, inwiefern Staat und Gesellschaft Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern übernehmen sollten. Je nach politischem Standpunkt konnte Familienschutz etwas anderes bedeuten. Dabei überlappten sich moralische, wirtschaftlich-soziale, bevölkerungspolitische und eugenische Stossrichtungen. Bürgerliche Sozialreformer engagierten sich für die sittliche Regeneration der Familie, linke Kreise erhofften sich eine Besserstellung der Arbeiterfamilien, Frauenorganisationen warben für die Einführung des Frauenstimmrechts und für Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern, Anhänger der katholischen Soziallehre träumten von einer umfassenden Aufwertung der Familie als der organischen Grundlage des Gemeinwesens. Beim Ausbau der Sozialversicherungen standen sich zwei Ansätze gegenüber. Die Mutterschaftsversicherung stand für einen individualistischen Ansatz, der die einzelne Frau ins Zentrum stellte. Dem gegenüber standen sozialpolitische Modelle, die die kollektiven Bedürfnisse der Familiengemeinschaft betonten und den Familienschutz etwa durch Familienzulagen zu erweitern suchten. Generell erhielt das traditionelle Familienmodell, das dem Mann die Ernährerrolle zuweist, in der Zwischenkriegszeit Auftrieb. Auch die Praxis der Fremdplatzierungen und damit verbundener fürsorgerischer Zwangsmassnahmen wie die administrativen Versorgungen von Erwachsenen erreichte einen vorläufigen Höhepunkt. Betroffen waren insbesondere Familien aus den Unterschichten oder von diskriminierten ethnischen Gruppen wie den Jenischen.
Zu einer gewissen Bündelung von familienpolitischen Anliegen kam es 1931 auf einer Studientagung, die von der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik organisiert wurde, sowie ab 1933 im Rahmen der breit abgestützten Familienschutzkommission, die organisatorisch bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) angesiedelt war. Nach 1940 profilierte sich Bundesrat Philipp Etter als Initiant mehrerer Bevölkerungs- und Familienschutzkonferenzen. 1941 lancierte die Katholisch-Konservative Volkspartei die Volksinitiative „Für die Familie“, die die Familie zur „Grundlage von Staat und Gesellschaft“ erklärte und einen umfassenden Schutz der Familie versprach. Dank der Unterstützung durch katholische Gewerkschaften, Bauernvertreter und die Familienschutzkommission der SGG konnte das Volksbegehren 1942 mit 170.000 Unterschriften eingereicht werden. Die Initianten präsentierten ihre Vorlage zunächst als politische Alternative zum Projekt für eine Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), das vor allem von Freisinnigen und Sozialdemokraten unterstützt wurde. Als der Bundesrat 1944 einen Gegenvorschlag präsentierte, der wichtige Anliegen aufnahm, zogen sie das Volksbegehren zurück.
Ein wichtiger Aspekt der Debatte über den wirtschaftlichen Schutz der Familie war die Kontroverse über Individual- und Soziallöhne. Dabei ging es um die Frage, ob Löhne allein die individuelle Arbeitsleistung oder auch die sozialen Verpflichtungen honorieren sollten, die mit der Ernährung einer Familie verbunden waren. Das Konzept des Familienlohns, bei dem das Salär des Familienvaters und die Kinderzahl im Zentrum standen, fand vor allem in katholisch-konservativen Kreisen Zuspruch. Die gleichen Kreise führten in den 1930er-Jahren heftige Kampagnen gegen Zweitverdiener, wobei ihnen vor allem die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen ein Dorn im Auge war. Zu den Verteidigern des Individuallohns gehörten dagegen die Gewerkschaften und Arbeitgeber, aber auch Frauenorganisationen kämpften gegen die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen. Auch sie waren allerdings bereit, familiäre Verpflichtungen mittels spezieller Zulagen abzugelten.
Solche Familienzulagen waren zu Beginn der 1930er-Jahre in Frankreich und Belgien eingeführt worden. In der Schweiz kamen seit 1927 die Bundesbeamten in den Genuss von Familienzulagen. Bis 1937 hatten dann 110 Unternehmen der Privatwirtschaft mit insgesamt 18.000 Beschäftigten ein ähnliches Zulagensystem eingeführt. Vor allem in der Romandie schlossen sich viele Betriebe – nach dem Vorbild Frankreichs – einer Familienausgleichskasse an, die den Lastenausgleich innerhalb einer Branche übernahm. 1939/40 sollte das Ausgleichskassensystem dann für die Lohn- und Verdienstersatzordnung (LVEO) übernommen werden, die militärdienstleistende Familienväter ebenfalls privilegierte – und erwerbstätige (und beitragspflichtige) Frauen ganz von Leistungen ausnahm. Parallel zur LVEO kam es in den Kriegsjahren zu einem eigentlichen Boom. Zahlreiche Branchen führten Familienzulagen ein und gründeten Ausgleichskassen. 1943/44 beschlossen die Kantone Waadt und Genf sogar ein Obligatorium für alle Beschäftigten.
Auf Bundesebene wurden Familienzulagen im Zusammenhang mit der Initiative der Katholisch-Konservativen aktuell. Die Gilde der Familienschützer war allerdings uneinig, nach welchen Kriterien Familienzulagen verteilt werden sollten. Offen war, ob der Staat oder private Körperschaften Leistungen ausrichten und ob alle oder nur kinderreiche Familien von Zulagen profitieren sollten. Einen weiteren Rückschlag bedeutete der Entscheid des Bundesrats, die Überschüsse der LVEO für die Altersvorsorge einzusetzen und der Realisierung der AHV Priorität einzuräumen. Um dem Volksbegehren „Für die Familie“ entgegenzukommen und die AHV nicht zu gefährden, sah der Gegenvorschlag von Parlament und Bundesrat schliesslich neben dem generellen Bekenntnis zum Familienschutz und der Einführung einer Mutterschaftsversicherung auch eine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes auf dem Gebiet der Familienausgleichskassen vor. Nach dem Rückzug der Initiative stimmten Volk und Stände am 25. November 1945 dem neuen Familienschutzartikel in der Bundesverfassung (Artikel 34quinquies) schliesslich mit deutlichem Mehr zu.
Späte Umsetzung: Mutterschaftsentschädigung und Familienzulagen
Mutterschaftsversicherung und Familienzulagen erhielten 1945 ihre Verfassungsgrundlage im gleichen Urnengang. Trotzdem wiesen sie unterschiedliche Stossrichtungen auf. Erleichterte die Mutterschaftsversicherung grundsätzlich die Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft, so zielten Familienzulagen eher darauf ab, das traditionelle Familienmodell mit dem Mann in der Ernährerrolle zu stärken und den Druck auf verheiratete Frauen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, zu verringern. In einer Hinsicht sollten die beiden Zweige der Sozialen Sicherheit allerdings das Schicksal teilen: beiden stand 1945 noch ein ausserordentlich langer Weg bis zur Realisierung auf Bundesebene bevor.
International hatten verschiedene Staaten bereits Lösungen ausgearbeitet. In Deutschland wurde 1927 das Mutterschutzgesetz geschaffen. Für einen festgelegten Zeitraum unterstanden die Frauen einem Kündigungsschutz und durften die Arbeit aussetzen. Sie erhielten ein Wochengeld; zudem wurden Stillpausen eingeführt. 1952 wurde in der frühen Bundesrepublik ein neues Mutterschutzgesetz erlassen, das eine Entschädigung für den Erwerbsausfall garantierte. Frankreich sicherte Frauen mit einem Gesetz von 1946 einen 14-wöchigen Mutterschutz zu, wobei der Erwerbsausfall zu 50 Prozent vergütet wurde. Vergleichsweise früh führten Länder im skandinavischen Raum eine Elternzeit ein. In Schweden erhielten Mütter seit 1963 einen sechsmonatigen Mutterschutzurlaub. 1974 wurde der Anspruch auf Väter ausgedehnt. In den USA hingegen besteht bis heute nur ein Anrecht auf unbezahlten Mutterschutz. Verschiedene Bundesstaaten bieten aber auch finanzielle Unterstützung an.
In der Schweiz sollte sich nach 1945 – wie bereits in der Zwischenkriegszeit – vor allem die Verknüpfung mit der Krankenversicherung als Hemmschuh erweisen. 1946 setzte der Bundesrat eine Expertenkommission für die Mutterschaftsversicherung ein, der mit Margarita Schwarz-Gagg auch eine Vertreterin des Bunds Schweizerischer Frauenvereine angehörte. Bereits 1948 koppelte die Regierung die Vorlage allerdings an die Revision des KUVG, so dass eine eigenständige Mutterschaftsversicherung für Jahrzehnte von der politischen Agenda verschwand. Die Revision des KUVG von 1964 erweiterte lediglich den Wöchnerinnenschutz für versicherte Frauen, weitere Reformen gerieten infolge des Doppel-Neins zur Neuausrichtung der Krankenversicherung von 1974 auf die lange Bank. Ende der 1970er-Jahre lancierten Frauenorganisationen, Gewerkschaften und linke Parteien deshalb eine Volksinitiative, die die bestehende Verfassungsbestimmung konkretisierte und ihre Umsetzung innert fünf Jahren vorsah. 1984 erteilte der Souverän der Vorlage indes eine deutliche Abfuhr. Das gleiche Schicksal erlitt 1987 die Totalrevision der Krankenversicherung, zu der eine über Lohnprozente finanzierte Mutterschaftsversicherung für erwerbstätige und nicht erwerbstätige Frauen gehört hätte. Der Frauenstreik von 1991 bildete dann den Auftakt für eine neue Kampagne der Frauenorganisationen, die auf Regierungsebene von Bundesrätin Ruth Dreifuss unterstützt wurde. Ein neuer Lösungsvorschlag, der eine Finanzierung über Mehrwertsteuerprozente vorsah, erlitt aber 1999 an der Urne erneut Schiffbruch. Allerdings hatten sich die politischen Prioritäten – dreissig Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts und zwanzig Jahre nach dem Gleichstellungsartikel – nun definitiv verändert. Die Erwerbstätigkeit von Frauen und damit die Notwendigkeit einer Absicherung der Mutterschaft wurden auch von bürgerlicher Seite nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Zudem war das Problem der geburtsbedingten Pflegekosten gelöst, nachdem 1994 das Obligatorium in der Krankenversicherung eingeführt worden war. Der Kanton Genf realisierte 2001 deshalb kurzerhand eine kantonale Versicherung. Fünf Jahre nach dem Scheitern der Vorlage von 1999 schaffte schliesslich eine neue Vorlage den Durchbruch. Die Mutterschaftsentschädigung, die 2004 beschlossen wurde, lehnt sich eng an die Erwerbsersatzordnung an und wird wie diese über Lohnabzüge finanziert. Sie garantiert während 14 Wochen 80 Prozent des letzten Einkommens. Im Gegensatz zu früheren Vorlagen kommen jedoch nur Frauen in den Genuss von Leistungen, die vor der Niederkunft erwerbstätig waren. Im internationalen Vergleich ist dieser Mutterschaftsurlaub knapp bemessen. In Frankreich haben Mütter Anspruch auf 16 Wochen, in Deutschland dauert die bezahlte Elternzeit – für Mütter und Väter – bis zu einem Jahr, in Schweden sogar bis zu insgesamt 480 Tagen. Im Gegensatz zu vielen anderen Industrieländern gewährte die Schweiz Vätern lange Zeit keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub. Nach der Einführung der Mutterschaftsversicherung 2005 verstärkten sich die Forderungen nach einem analogen Modell für Väter. 2017 reichten Väter- und Mütterorganisationen sowie Gewerkschaften eine Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub» ein. Die Initistive schlug einen 20-tägigen bezahlten Vaterschaftsurlaub vor. Im September 2019 nahm das Parlament den Gegenvorschlag eines 10-tägigen Vaterschaftsurlaub an. Parallel zu diesen Beratungen wurden auch weitergehende Vorstösse für eine Elternzeit lanciert, die zwischen Müttern und Vätern aufgeteilt werden kann.
Auch der Bereich der Fremdplatzierungen und fürsorgerischen Zwangsmassnahmen erlebte in der Nachkriegszeit einen Umbruch. Grundsätzlich stützten sich die Behörden im 20. Jahrhundert bei Fremdplatzierungen auf drei Rechtsinstrumente: das Armenrecht, das Vormundschaftsrecht des ZGB sowie Gesetze für administrative Versorgungen. Armenrechtliche Versorgungen gingen nach der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre stark zurück und wurden nach dem Zweiten Weltkrieg durch vormundschaftsrechtliche Platzierungen verdrängt, die häufig von sittlich-moralischen Vorbehalten gegenüber unkonventionellen Lebensstilen ausgingen. Die administrativen Versorgungen von Jugendlichen und Erwachsenen wurden seit den 1960er Jahren aus bürger- und menschenrechtlicher Perspektive zunehmend kritisiert, insbesondere weil das Administrativrecht keine gerichtlichen Rekursmöglichkeiten kannte. 1974 unterzeichnete die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention. Im Anschluss daran wurde das Instrument der administrativen Versorgungen mit der ZGB-Revision von 1981 ersetzt durch den Fürsorgerischen Freiheitsentzuges, der mit erweiterten Rekursrechten verbunden war. Auch das Vormundschaftsrecht wurde modernisiert. 2013 wurde im Rahmen einer weiteren ZGB-Revision das Vormundschaftsrecht ersetzt durch eine Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzgebung. Damit wurden kommunale Vormundschaftsbehörden durch stärker zentralisierte und professionalisierte Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) ersetzt.
Auch bei den Familienzulagen kam, analog zur Mutterschaftsversicherung, eine bundesrechtliche Regelung lange nicht voran. International haben sich unterschiedliche Modelle durchgesetzt. In Deutschland wird heute ein «Kindergeld» ausgerichtet. Einkommensstärkere Familien profitieren von einem von der Steuer absetzbaren Freibetrag, während Familien mit geringem Einkommen Kindergeld erhalten. In Frankreich werden Familienzulagen nur an Familien mit mindestens zwei Kindern gewährt. In den skandinavischen Ländern besteht für Eltern neben den Kinderzulagen nach der regulären Elternzeit die Möglichkeit, für die ersten Jahre des Kleinkinds zusätzlich Erziehungsgeld zu beantragen. Diese materielle Unterstützung ermöglicht es den Eltern zu entscheiden, ob sie sich tagsüber selbst um ihre Kinder sorgen oder sie extern betreuen lassen.
In der Schweiz verhinderte das Aktivwerden der Kantone eine Blockade wie im Fall der Mutterschaftsversicherung. Der Bund regelte 1952 lediglich die Auszahlung von Familienzulagen an landwirtschaftliche Angestellte und Bergbauern, wobei weniger sozial- als regionalpolitische Zielsetzungen – insbesondere die Verringerung der Landflucht – im Vordergrund standen. In dieser Situation ergriffen die Kantone die Initiative. In den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten führten alle Kantone Familien-, später zum Teil auch Geburts- und Ausbildungszulagen ein. Der Kanton Tessin richtete ab 1996 sogar existenzsichernde Zulagen für Familien mit Kindern unter 15 Jahren aus. Finanziert wurden die Familienzulagen ausschliesslich durch Beiträge der Arbeitgeber (ausser im Kanton Wallis, wo auch die Lohnempfänger einen bescheidenen Beitrag leisten müssen). Die Beiträge und Leistungen variierten von Kanton zu Kanton. Auch das Ausgleichskassensystem entwickelte sich weiter. 2004 bestanden in der Schweiz rund 115 öffentliche oder private Familienausgleichskassen, die zum Teil in mehreren Kantonen tätig waren. Auf Bundesebene gab es seit Beginn der 1990er-Jahre Pläne zu einer Harmonisierung der unterschiedlichen Regelungen. Parallel dazu wurde – bisher ohne konkretes Ergebnis – über eine Erweiterung der Ergänzungsleistungen für Familien diskutiert. Zum Durchbruch gelangten die Vereinheitlichungsbestrebungen schliesslich durch die Volksinitiative für faire Kinderzulagen, die 2003 von der Gewerkschaft Travail.Suisse lanciert wurde. Das Familienzulagengesetz, das 2006 als indirekter Gegenvorschlag zu dieser Initiative zustande kam, vereinheitlichte – und erhöhte – die vorgesehenen Ansätze. Noch einen Schritt weiter gingen die Kantone Solothurn, Waadt, Genf und Tessin, die allesamt bedarfsabhängige Familienergänzungsleistungen eingeführt haben.
> Die Erwerbsausfall- und Mutterschaftsentschädigung in Zahlen
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Hauss Gisela, Gabriel Thomas, Lengwiler Martin (ed.) (2018), Fremdplatziert. Heimerziehung in der Schweiz 1940-1990; Schumacher Beatrice (2009), Familien(denk)modelle. Familienpolitische Weichenstellungen in der Formationsphase des Sozialstaats (1930–1945), in M. Leimgruber, M. Lengwiler (ed.), Umbruch an der „inneren Front“. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz, 1938–1948, 139–163, Zürich; Wecker Regina, Studer Brigitte, Sutter Gaby (2001), Die „schutzbedürftige Frau“. Zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung, Zürich; Studer Brigitte (1997), Familienzulagen statt Mutterschaftsversicherung?. Die Zuschreibung der Geschlechterkompetenzen im sich formierenden Schweizer Sozialstaat, 1920–1945, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 47, 151–170; Doris Huber (1991), Familienpolitische Kontroversen in der Schweiz zwischen 1930 und 1984, in T. Fleiner-Gerster et al. (ed.), Familien in der Schweiz, 147–166, Fribourg. HLS / DHS / DSS: Familienzulagen; Mutterschaft.
(01/2020)