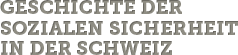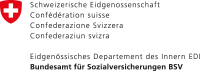Unternavigation
In den 1970er-Jahren kam die Krankenversicherung erneut auf die politische Agenda. Einmal mehr stand ein allgemeines Versicherungsobligatorium zur Debatte. Nach der Ablehnung des Tuberkulosegesetzes (1949) war diese Frage in den Hintergrund geraten. Die erste Teilrevision des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes von 1964 hatte sich auf punktuelle Anpassungen beschränkt. Angesichts der rasant ansteigenden Kosten im Gesundheitswesen setzte Ende der 1960er-Jahre eine Reformdebatte ein. Wie bereits 1964 beteiligten sich daran nicht nur die politischen Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Vor allem die Krankenkassen, die Ärzteschaft und die Pharmaindustrie machten dem Parlament, Bundesrat und Bundesamt für Sozialversicherung die Meinungsführerschaft strittig. Im Kern drehte sich die vertrackte Diskussion um zwei Grundsatzfragen: Sollte die Schweiz wie andere Länder und von der Linken seit langem gefordert die Kranken- und Unfallversicherung obligatorisch erklären? Und: Wie sollten die Leistungen künftig finanziert werden? Diesbezüglich stand neu die Option einer Finanzierung über Lohnprozente im Raum.
Am 8. Dezember 1974 standen die Stimmberechtigten vor der Wahl zwischen drei Varianten: Eine Volksinitiative der Sozialdemokratischen Partei verlangte ein umfassendes Versicherungsobligatorium (Krankenpflege, Mutterschaft, Unfallversicherung), das unter anderem über Lohnprozehnte finanziert werden sollte. Der Gegenvorschlag des Parlaments, hinter dem die bürgerlichen Parteien, Verbände, Krankenkassen und Ärzte standen, verzichtete demgegenüber auf das Versicherungsobligatorium bei den ambulanten Behandlungen. Er sah hingegen eine obligatorische Versicherung für stationäre Behandlungen vor, die über Lohnabzüge finanziert werden sollte. In Anlehnung an einen Sitzungsort bezeichnete ein 1972 erstellter Expertenbericht diese obligatorische Spitalversicherung als „Flimser Modell“. Die Stimmberechtigten hatten schliesslich eine dritte Möglichkeit: Sie konnten beide Vorlagen ablehnen und sich für den Status quo entscheiden. Die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern entschied sich nach einem engagierten Abstimmungskampf für ein doppeltes Nein und favorisierte damit den Status quo. Damit war - nach 1900 und 1949 - ein weiterer Anlauf für eine (teilweise) obligatorische Krankenversicherung gescheitert. Zählt man die Ja-Stimmen für beide Vorlagen zusammen, hatte sich indes sehr wohl eine Mehrheit für eine Neuausrichtung der Krankenversicherung ausgesprochen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Alber Jens, Bernardi-Schenkluhn Brigitte (1992), Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Frankfurt; Sommer Jürg (1978), Das Ringen um die soziale Sicherheit in der Schweiz. Eine politisch-ökonomische Analyse der Ursprünge, Entwicklungen und Perspektiven sozialer Sicherung im Widerstreit zwischen Gruppeninteressen und volkswirtschaftlicher Tragbarkeit, Diessenhofen; HLS / DHS / DSS: Krankenversischerung.
(12/2016)