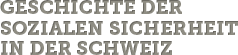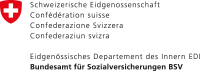Unternavigation
Arbeit und Berufsunfälle
Ein Grossteil der Sozialen Sicherheit dient dazu, Schutz vor den Risiken der modernen Arbeitswelt zu bieten. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts ist dies gar das Hauptanliegen der Sozialversicherungen in der Schweiz.
Als Behörden und Parteien in der Schweiz ab den 1860er-Jahren über Arbeitsschutz und Sozialversicherungen diskutierten, galt die Sorge in erster Linie den Risiken der Fabrikarbeit. In den jungen Industrien entstanden seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert völlig neue Arbeitsverhältnisse mit bisher unbekannten Arbeitsrisiken. Der Fokus auf die Industriearbeit hatte nachhaltige Folgen. Die Einrichtungen des Sozialstaats blendeten Gefahren in nicht-industriellen Branchen und Bereichen, etwa in der Landwirtschaft oder im Haushalt, bis ins 20. Jahrhundert weitgehend aus.
Im Industriesektor waren die neuen Arbeitsrisiken besonders augenfällig. Frühe Formen industrieller Produktion, etwa im Textilsektor, hatten noch weitgehend auf Heimarbeit beruht, die wegen ihren langen Arbeitszeiten in der Kritik stand. Angetrieben durch die Mechanisierung der Spinnerei und Weberei wurde Heimarbeit im 19. Jahrhundert zunehmend durch Fabrikarbeit ersetzt. Die Fabrikproduktion, die sich von der Textil- über die Maschinenindustrie auch auf andere Branchen übertrug, galt als besonders gefährlich. Zu den kritischen Stimmen gehörten philanthropische Gesellschaften und Arbeitervereine, aus denen sich später die modernen Gewerkschaften entwickelten. In den industriellen Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, etwa der Eisenbahn, erkannten die Zeitgenossen symbolhafte Risikoträger des industriellen Zeitalters. Auch das Entschädigungsmodell, das damit verbunden war, barg Gefahren. Industriearbeit wurde durch einen Lohn entgolten. Arbeiterinnen und Arbeiter gerieten damit in neue Abhängigkeiten. Konjunkturelle Einbrüche oder Krisen führten dazu, dass in Industrieregionen auf einen Schlag grosse Teile der Bevölkerung ohne Erwerb dastanden und verarmten. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts breiteten sich Absicherungen wie frühe Kranken- oder Arbeitslosenkassen langsam aus. Industriell bedingte Armutsphasen stellten deshalb vor allem die lokalen Behörden, insbesondere die Armenhilfe, vor schwer lösbare finanzielle und sozialpolitische Aufgaben. Hinzu kam, dass in Branchen wie der Textilindustrie viele Frauen und Kinder arbeiteten, die als besonders schutzwürdig galten. Parallel zur Ausbreitung der Volksschule und bürgerlicher Familienideale entwickelte sich die Regulierung der Kinderarbeit und des Frauenarbeitsschutzes zu Kernanliegen der frühen gesetzlichen Vorkehrungen gegen die Risiken der Industriearbeit. Der Aufstieg der risikoreichen chemischen und elektrotechnischen Industrien im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert verstärkte das Bedürfnis nach einem griffigen Arbeitsschutz weiter.
Auf nationaler Ebene markierte das eidgenössische Fabrikgesetz von 1877 einen wichtigen Meilenstein in der staatlichen Regulierung der Fabrikarbeit. Es verbot die Arbeit von Kindern unter 14 Jahren im Industriesektor (nicht aber in der Landwirtschaft), legte als maximale Arbeitszeit den Elfstundentag fest und machte Unternehmer für arbeitsbedingte körperliche Schädigungen haftbar. Auch wurde ein System eidgenössischer Fabrikinspektoren eingeführt. Der erste und bis heute bekannteste unter ihnen war der Glarner Arzt Fridolin Schuler.
1881 folgte ein Haftpflichtgesetz, das den Grundsatz der unternehmerischen Haftpflicht nochmals bestärkte und die Unternehmer vermehrt dazu brachte, sich bei Privatversicherern gegen Unfallrisiken zu versichern. 1912 kam im zweiten Anlauf das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz zustande, das im Unfallbereich die bisherige Haftpflichtregelung durch eine obligatorische Versicherungspflicht ersetzte und einen Grossteil des Unfallversicherungsmarktes verstaatlichte. Die Durchführung der staatlichen Unfallversicherung wurde 1918 der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) übertragen. Unterstellt waren industrielle und gewerbliche Berufe. Die Suva legte den Unfallbegriff breit aus: auch anerkannte Berufskrankheiten und Freizeitunfälle waren mitversichert. Parallel dazu verstärkten die Bundesbehörden 1920 den Frauenarbeitsschutz, insbesondere durch das Verbot von Frauenarbeit in gesundheitsgefährdenden Beschäftigungen. Auch die Arbeitszeit wurde durch Einführung der 48-Stunden-Woche weiter eingeschränkt, wobei dieser Grundsatz sich erst in den 1930er-Jahren allgemein durchsetzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg übertrug das Arbeitsgesetz von 1964 den Arbeitsschutz auf den Dienstleistungssektor. Seit 1984 sind alle unselbständig Erwerbstätigen, auch jene im Agrarsektor, der obligatorischen Unfallversicherung unterstellt. In den 1990 Jahren forderten insbesondere Arbeitgeberverbände eine Deregulierung des Arbeitsgesetzes. Die Revision von 1998 hob das Nachtarbeitsverbot für Frauen auf, dehnte die bewilligungsfreie Arbeitszeit bis abends um 23.00 Uhr aus und regelte die Zuschläge für Nachtarbeit neu. Kantonale Arbeitsinspektorate kontrollieren die Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes. Sie werden durch die eidgenössische Arbeitsinspektion beaufsichtigt und koordiniert.
Anfangs des 20. Jahrhunderts, bei der Einführung der Unfallversicherung, orientierten sich die Behörden vor allem am deutschen Modell. Unter Bismarck schuf das deutsche Kaiserreich in den 1880er Jahren die weltweit erste staatliche Unfallversicherung, deren Durchführung branchenspezifischen Berufsgenossenschaften überlassen wurde. Diese öffentlich-rechtlichen Organisationen setzten sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen zusammen. Die Schweiz übernahm diese Organisationsform, wobei anders als in Deutschland nur eine zentrale Organisation – die Suva – und nicht eine Vielzahl berufsspezifischer Genossenschaften errichtet wurde. Ähnlich wie die deutschen Berufsgenossenschaften ist die Suva korporatistisch aufgebaut, unter Einbezug von Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Behördenvertretern. Zudem sind das Beitragssystem und die Präventionsarbeit berufsspezifisch organisiert. Das Gegenmodell bildeten jene Staaten, in denen der Unfallschutz durch ein Haftpflichtgesetz geregelt war und die Arbeitgeber sich bei der privaten Versicherungsindustrie gegen das Haftpflichtrisiko bei Arbeitsunfällen versicherten. An diesem zweiten Modell orientierten sich unter anderem Grossbritannien, Frankreich und vor allem die USA, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg.
Die Wahrnehmung der Arbeitsrisiken orientierte sich lange Zeit an den Gefahren der Fabrikarbeit und damit an männerdominierten Arbeitsplätzen. Frauenspezifische Berufsrisiken wurden ungenügend oder nur verspätet wahrgenommen. Dies gilt etwa für die Berufsrisiken im Gesundheitswesen (etwa in Pflegeberufen), in Büroberufen oder im Haushalt, die erst seit den 1970er- und 1980er-Jahren in Unfallverhütungskreisen breiter diskutiert wurden.
Dank der statistischen Erfahrungswerte der Suva lässt sich die Entwicklung der versicherten Arbeitsrisiken im 20. Jahrhundert und frühen 21. Jahrhundert in Umrissen rekonstruieren. Generell gilt, dass die Unfallrisiken am Arbeitsplatz von ganz unterschiedlichen Faktoren abhingen: Vorkehrungen zur Unfallverhütung, der Veränderung der Wirtschaftsstruktur und der Wirtschaftslage, technischen Fortschritten, der Unternehmensorganisation und individuellen Gefahrenwahrnehmungen. Eine überhitzte Konjunktur provozierte mehr Unfälle als eine Konjunkturflaute, Betriebe mit aktiver Unfallverhütung hatten niedrigere Unfallraten als Firmen, die nicht in die Prävention investieren. Seit dem frühen 20. Jahrhundert haben die Unfallrisiken am Arbeitsplatz um rund einen Drittel abgenommen. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung war der Aufstieg des Dienstleistungssektors nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch wenn einzelne Dienstleistungsberufe, wie etwa der Pflegeberuf, durchaus hohe Arbeitsrisiken besassen, war das Risikopotenzial im tertiären Sektor durchschnittlich geringer als im Industriesektor. Wie gross der Anteil der von der Suva geförderten Unfallverhütung an diesem Trend ist, lässt sich nicht präzise berechnen. Eine gegenläufige Entwicklung zeigte sich nur während des Zweiten Weltkriegs, als das Unfallrisiko um rund einen Viertel anstieg. Heute ereignen sich auf 100 versicherte Personen jährlich knapp 7 Berufsunfälle.
Völlig anders verlief die Entwicklung der Freizeitunfälle, die sich zum Grossteil aus Verkehrs- und Sportunfällen zusammensetzen. Hier stieg die Anzahl Unfälle pro Jahr und versicherter Person kontinuierlich an, bis auf jährlich knapp 13 Fälle auf 100 versicherten Personen im Jahr 2013. Insgesamt verdoppelte sich das Unfallrisiko im Freizeitbereich in den letzten hundert Jahren. Dieser Trend wiederspiegelt die steigende Motorisierung der Gesellschaft sowie die Reduktion der Jahresarbeitszeit durch den ausgebauten Ferien- und Freizeitanspruch.
Eine Sonderrolle innerhalb der Arbeitsrisiken nehmen Berufskrankheiten ein. Sie sind gegenüber den Arbeitsunfällen oft schwerer zu diagnostizieren, nicht zuletzt wegen ihres schleichenden Verlaufs. Die Suva hat sich mit der Aufnahme ihres Betriebs 1918 entschieden, anerkannte Berufskrankheiten in den Versicherungsschutz aufzunehmen. Damit eine Berufskrankheit anerkannt werden konnte, verlangte die Suva allerdings den Nachweis, dass die toxische Substanz am Arbeitsplatz einen kausalen Zusammenhang mit dem Krankheitsbild hatte. Diesen Nachweis zu erbringen, erwies sich bei neuen oder unkonventionellen Berufskrankheiten oft als schwierig. Unbestritten versichert waren Schädigungen durch Substanzen wie Bleiweiss im Malereigewerbe, Phosphor in der Zündholzherstellung oder das krebserregende Anilin in der chemischen Industrie. Andere Stoffe wie der Quarzstaub, der zu chronischen Lungenbeschwerden (Silikose) mit Invaliditäts- und Todesfolgen führen konnte, oder im Haushalt verwendete Giftstoffe wurden dagegen lange unterschätzt. Quarzstaub wurde erst 1937, nach jahrelangen Diskussionen, definitiv auf die Berufskrankheitsliste gesetzt. 1960 wechselte die Suva das Klassifikationssystem und führte als Kriterium zur Beurteilung von Berufskrankheiten die sogenannte „Maximale Arbeitsplatz-Konzentration“ (MAK) ein. Im Unterschied zum früheren Modell legten die MAK-Werte einen Grenzwert an toxischen Substanzen fest, der am Arbeitsplatz nicht überschritten werden durfte.
Die Diskussion um Berufskrankheiten hat sich in den letzten Jahren in neue Richtungen entwickelt. Dabei rückten zunehmend Gesundheitsstörungen mit komplexen Ursachen in den Blick, die nicht unter den herkömmlichen Begriff der Berufskrankheiten fallen. Unter dem neuen Begriff der psychosozialen Risiken werden Risiken für die Gesundheit zusammengefasst, die durch ein ungünstiges Klima am Arbeitsort und eine ungünstige Arbeitsorganisation und -gestaltung ausgelöst werden. Zu solchen berufsassoziierten Störungen gehören Stress, Burnout oder diffuse Rückenbeschwerden. Die Suva schliesst diese Störungen ebenso wie verschiedene umstrittene Krankheiten bislang von Versicherungsleistungen aus, hat aber in den letzten Jahren die Forschung in diesem Bereich verstärkt, um mehr über deren Ursachen zu erfahren und angemessene Präventionsmittel zu entwickeln. Das Arbeitsrecht hält allerdings die Arbeitgeber dazu an, auslösende Faktoren von psychosozialen Risiken zu minimieren. Ab 2014 hielt das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die Arbeitsinspektorate dazu an, ihr Augenmerk auf die Prävention von psychosozialen Risiken zu lenken.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Schaad, Nicole (2003), Chemische Stoffe, giftige Körper: Gesundheitsrisiken in der Basler Chemie, 1860-1930, Zürich; Lengwiler, Martin (2006), Risikopolitik im Sozialstaat. Die schweizerische Unfallversicherung 1870-1970. HLS / DHS / DSS: Arbeitsmedizin, Arbeitszeit, Fabrikgesetze; Website 100 Jahre Suva: https://www.suva.ch/de-ch/die-suva/100-jahre-suva
(01/2019)