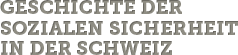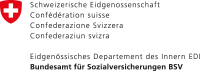Unternavigation
Armut
Armut ist das Produkt ungleicher Gesellschaften. Wahrgenommen wird Armut erst, wenn sie gesellschaftlich thematisiert und für problematisch befunden wird. Die Kategorie der Armen ist deshalb die Folge einer speziell auf Arme ausgerichteten Sozialpolitik. Bis Ende des 19. Jahrhunderts fühlte sich der Staat nur bedingt für das Problem der Armut zuständig. In erster Linie kümmerten sich die private Wohltätigkeit, die Kirche oder die Familie um die Armen. Erst mit dem Aufkommen der Arbeiterbewegung, der Industrialisierung und der Urbanisierung ging die Armutsbekämpfung in die Zuständigkeit der öffentlichen Hand über.
Die Kategorisierung der Armen
Armut wurde seit dem 15. Jahrhundert zunehmend gesellschaftlich geächtet. Die Obrigkeiten sprachen einzelnen Gruppen von Armen das Recht auf Unterstützung ab und kriminalisierten die Betroffenen. „Unwürdigen“ Armen wurde vorgeworfen, eine verwerfliche Einstellung zu haben und an ihrer Situation mitschuldig zu sein.
Ende des 19. Jahrhunderts verabschiedeten oder revidierten die meisten Schweizer Kantone ihre Armengesetzgebungen. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf «unglückliche und verlassene Kinder» gerichtet, das heisst auf Waisenkinder, aber auch Kinder aus armen Familien, denen vorgeworfen wurde, ihre Kinder materiell und moralisch verwahrlosen zu lassen. Im Interesse der öffentlichen Ordnung sollten solche Kinder zur Einhaltung gesellschaftlicher Normen und zur Arbeitsdisziplin erzogen werden (Heime und Anstalten). Auch verarmte Erwachsene wurden als administrativ Versorgte in geschlossene Anstalten eingewiesen und dort häufig zur Arbeit gezwungen. Damit knüpften die Behörden an eine Politik der Arbeitspflicht für Arme an, die seit dem Mittelalter existierte und als Zwangsarbeit (Schellenwerk) oder in Spitälern verrichtet wurde. Im 17. Jahrhundert wurden spezifische Zwangsarbeits- oder Korrektionsanstalten gegründet oder bestehende Spitäler zu solchen umfunktioniert. Die Praxis hielt bis weit ins 20. Jahrhundert an.
Als unterstützungswürdig galten Arme, die wegen Krankheit, Invalidität oder Alter nicht arbeiten konnten („unfreiwillige“ oder „ehrbare“ Arme). In landläufiger Sicht verdienten ältere Menschen umso mehr Unterstützung, als sie bereits ein arbeitsreiches Leben hinter sich hatten. Ende des 19. Jahrhunderts waren vor allem viele Witwen auf Unterstützung angewiesen. Sie konnten aufgrund ihres Alters und der früheren Abhängigkeit vom Ehemann oft nicht selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen: Der Staat trat dann an die Stelle des Ernährers. Die Armenunterstützung ermöglichte aber auch eine soziale Kontrolle der betroffenen Frauen, die nicht mehr der Aufsicht des Ehemanns unterstanden, namentlich wenn es um die Sexualmoral ging.
Eine weitere Kategorie bildeten die «gesunden Armen»: Männer und Frauen, die an sich arbeitsfähig waren. Sie sollten nur ausnahmsweise von der Fürsorge unterstützt werden. Behörden und Sozialreformer setzten sich aber für die Arbeitseingliederung ein, beispielsweise durch die Schaffung von Landwirtschaftskolonien für Männer oder Nähateliers für Frauen.
Ob jemand Fürsorgeleistungen erhielt und welchen Status die unterstützten Personen hatten, hing vor allem vom Erwerbsstatus, von der Erwerbsfähigkeit und vom Zivilstand ab.
Überlebenshilfe für die «Bürgerinnen und Bürger»
Die meisten Kantone beschränkten den Anspruch auf Fürsorgeleistungen auf Kantonsbürgerinnen und -bürger: also auf jene Personen, die durch Herkunft oder (bei Frauen) Heirat das Gemeindebürgerrecht besassen oder dieses Recht käuflich erworben hatten. Massgebend war also ein Verständnis von Solidarität, das auf Blutsbanden beruhte und die Gemeinschaft als erweiterte Familie betrachtete. Die in einer Gemeinde nicht heimatberechtigten Bedürftigen konnten in ihre eigene Heimatgemeinde zurückgeschickt werden. Die Verfassung von 1874 sah die Möglichkeit des Entzugs der Niederlassungsbewilligung für Personen vor, die der öffentlichen Wohlfahrt zur Last fielen und denen die Heimatgemeinde die Unterstützung verweigerte. Mit der Einführung einer Unterstützung für Personen, die im Kanton wohnten, ohne dort heimatberechtigt zu sein, bildete der Kanton Neuenburg Ende des 19. Jahrhunderts eine seltene Ausnahme. Doch unabhängig davon, ob man den Grundsatz der Unterstützung der heimatberechtigten Bürger oder der Einwohner verfolgte, blieb das Prinzip gleich: Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die den Anspruch auf Unterstützung rechtfertigte, musste festgelegt, eingegrenzt und kontrolliert werden.
Nicht nur der Personenkreis mit Ansprüchen auf Fürsorgeleistungen, sondern auch die Höhe der Leistungen waren stark eingeschränkt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts genügte die Armenunterstützung kaum für Nahrung und Heizung. Beispielsweise betrug die Sozialhilfe 1879 in Lausanne kaum mehr als 20 Franken pro Monat, was rund einem Fünftel des Lohns eines Arbeiters entsprach. Die Obdachlosen erhielten eine Suppe sowie eine Unterkunft für eine Nacht und wurden danach in ihre Heimatgemeinden abgeschoben.
Die Sozialversicherungen zeichnen die Armutsgrenze neu
Die Gruppen der Bedürftigen, die von der öffentlichen Hand unterstützt werden, haben sich bis heute stark verändert. Seit 1918 war ein Teil der schweizerischen Bevölkerung gegen unfallbedingte Verdienstausfälle bei der Schweizerischen Unfallversicherung (Suva) versichert. Spezielle Massnahmen zur Unterstützung von Arbeitslosen reduzierten ebenfalls die Last der traditionellen Sozialhilfe, namentlich während der Krise der 1930er-Jahre. In diesem Zusammenhang wurde auch die Kategorie der Arbeitslosen offiziell definiert. Als arbeitslos wurden jene Personen anerkannt, die unfreiwillig und temporär ohne Arbeit waren. Da die Höhe der Arbeitslosenentschädigung an das letzte erzielte Einkommen gekoppelt und die Entschädigungsdauer begrenzt war, wurden viele Arbeitslose weiterhin von der Sozialhilfe unterstützt, insbesondere nachdem sie ausgesteuert wurden oder wenn sie keine ausreichende Entschädigung erhielten. Dieser Zustand herrscht bis heute.
Die Einführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung 1947 führte, zusammen mit Unterstützungen in Form von Ergänzungsleistungen (ab 1965), dazu, dass ein Teil der älteren Personen und Witwen ohne die traditionelle Sozialhilfe auskommen konnten. Auch Jugendliche und Kinder wurden nach und nach durch spezifische Einrichtungen und Strukturen unterstützt. 1960 wurde die Invalidenversicherung (IV) eingeführt, womit Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen nicht mehr auf die öffentliche Fürsorge angewiesen waren. Diese neuen Sozialleistungen sowie Fortschritte in der Medizin und Bemühungen um Wiedereingliederung reduzierten die Zahl der fürsorgeberechtigten Bedürftigen. Weiterhin von der Sozialhilfe unterstützt werden mussten jedoch Personen, die auf ihre Rente warteten oder keine Leistungen der Invalidenversicherung erhielten. Auch die Kostenübernahme für die medizinische Versorgung veränderte sich im Lauf des 20. Jahrhunderts. Im Unterschied zu anderen Staaten kennt die Schweiz allerdings bis heute keine Erwerbsausfallsversicherung im Krankheitsfall. Wegen der föderalen Struktur der öffentlichen Fürsorge und der wechselnden Gruppe von Bedürftigen sind bis etwa 1950 kaum verlässliche Zahlen zu den Fürsorgeleistungen vorhanden.
Von der Überlebenshilfe zum sozialen Existenzminimum
Bis zum Zweiten Weltkrieg blieben die Unterstützungsbeiträge bescheiden. 1940 betrug etwa die von der Stadt Lausanne ausgerichtete Unterstützung nicht mehr als 40 Franken pro Monat, was dem Gegenwert von 2 Kilo Brot und 2 Litern Milch pro Tag entsprach. Die unterstützten Personen waren daher häufig von der privaten Wohltätigkeit und anderen Hilfeleistungen abhängig, insbesondere von Naturalleistungen (Nahrungsmittel, Kleider, Brennholz). Erst im Lauf der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg entstand der Begriff des Existenzminimums. Ende der 1950er-Jahre erhielt ein Lausanner Sozialhilfebezüger 217 Franken pro Monat, was rund der Hälfte eines durchschnittlichen Monatseinkommens eines unqualifizierten Arbeiters entsprach.
Seit den 1960er-Jahren gibt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), eine 1905 entstandene Organisation der Vertreter von Gemeinden, Kantonen und privater Sozialwerke, Richtwerte für die Sozialhilfe heraus. Die Ansätze dieser Richtwerte wurden laufend erhöht. Die Sozialhilfe soll demnach nicht mehr nur das Existenzminimum sichern, sondern auch die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen. Die ausgerichteten Beträge hängen von der Grösse des Haushalts ab: sie betrugen 2013 etwas weniger als 1000 Franken pro Monat für eine alleinstehende Person, 2000 Franken für ein Paar mit zwei Kindern. Dazu kommen die Zahlungen für eine bescheidene Miete und die Prämien der Grundversicherung der Krankenkasse. Mit diesen Beträgen bleiben die Sozialhilfeempfänger in einer wirtschaftlich prekären Situation. Das Prinzip der Minimalhilfe soll zwar respektiert, gleichzeitig sollen die Leistungen aber unter den Löhnen auf dem Arbeitsmarkt bleiben. Da in der Schweiz ein gesetzlicher Mindestlohn fehlt, gibt es auch berufstätige Personen, die nicht das Einkommen erreichen, das von der Sozialhilfe als Existenzminimum festgelegt wird. 2004 erkannte die erste gesamtschweizerische Sozialhilfeerhebung das Phänomen der Working Poor und stellte fest, dass mehr als ein Viertel der unterstützten Personen eine Arbeit haben; darunter befinden sich 40 Prozent Vollzeitbeschäftigte.
Erweiterung der Unterstützten?
Die Definition der Solidargemeinschaft veränderte sich im Lauf des 20. Jahrhunderts aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der wirtschaftlichen Veränderungen. Der Grundsatz der wohnörtlichen statt heimatörtlichen Unterstützung setzte sich dank der Unterzeichnung interkantonaler Übereinkommen durch. Das erste Konkordat wurde bereits vor dem Ersten Weltkrieg von 18 Kantonen unterzeichnet und später wiederholt revidiert. Ab 1967 galt es für alle Kantone, so dass die wohnörtliche Unterstützung de facto für alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger eingeführt worden war. Der Grundsatz, der die Niederlassungsfreiheit aller schweizerischen Staatsbürgerinnen und -bürger garantierte, wurde nach einer Verfassungsänderung von 1975 schliesslich im Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger bestätigt.
Der Ausbau der Sozialversicherungen in den Nachkriegsjahren und den drei Jahrzehnten des Wirtschaftswachstums führten zu einem schwindenden politischen Interesse an der öffentlichen Wohlfahrt. Unterstützte Personen wurden zunehmend als Randständige betrachtet, die es wieder in die Gesellschaft einzugliedern galt. Die Sozialhilfe wurde zum «letzten Netz» der sozialen Sicherheit und vermittelte das Bild eines Sozialstaates, der ein so engmaschiges Netz bildet, dass niemand fallengelassen wird. Gleichzeitig wurde die Soziale Arbeit mit der Gründung von speziellen Schulen und dem erfolgreichen Einsatz neuer Methoden der individuellen Sozialarbeit (social case work) professionalisiert (1960-1975).
Die Wirtschaftskrise Mitte der 1970er-Jahre und die vorangehenden Jahre des gesellschaftlichen Aufbruchs führten zu einer Neudiskussion der Armutsursachen: Im Blick stand nun nicht mehr allein das Phänomen der sozialen Unangepasstheit, sondern auch Entlassungen und Arbeitslosigkeit. Vor dem Hintergrund der Krise der 1990er-Jahre entstanden unzählige Armutsstudien. Die Kantone verabschiedeten Sozialhilfegesetze zur Wiedereingliederung und Aktivierung. Die Reformen wurden nun in einem Klima umgesetzt, das von einer heftigen Kritik an den Sozialhilfesystemen geprägt war. Die traditionelle Missbrauchsrhetorik wurde reaktiviert, um die Sozialhilfe zu begrenzen, vermehrte Kontrolle zu rechtfertigen und den Eingliederungsdruck in die Arbeitswelt zu verstärken.
Im gleichen Zeitraum wurde das Recht auf Sozialhilfe für Nicht-Schweizer und -Schweizerinnen festgeschrieben. 1995 anerkannte das Bundesgericht ein allgemeines Recht auf Unterstützung bei Bedürftigkeit, das allen in der Schweiz niedergelassenen Personen unabhängig von ihrer Nationalität und dem Aufenthaltsstatus allein aufgrund ihrer Menschenwürde zukommt. Dies war ein neuer Grundsatz, der Eingang in die totalrevidierte Bundesverfassung von 1999 fand. Die Kriterien von Wohnort, Nationalität und Aufenthaltsstatus spielen bei der Bestimmung der Unterstützung jedoch weiterhin eine Rolle: Personen ohne festen Wohnsitz, Asylsuchende oder abgewiesene Asylsuchende erhalten niedrigere Leistungen. Die Unterstützung variiert auch zwischen den Kantonen, bleiben diese doch im Sozialhilfebereich autonom. Mehrere Kantone revidierten seit den 2000er Jahren ihre Gesetzgebungen, die meistens Kürzungen und strengere Auflagen für Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger zur Folge hatten. Infolgedessen passte auch die SKOS ihre Empfehlungen an.
Die 2021 eingeführten Überbrückungsleistungen sind die jüngste Sozialversicherung der Schweiz. Die Überbrückungsleistungen wurden für Personen geschaffen, die kurz vor der Pensionierung arbeitslos werden. Seit 2021 unterstützen die Überbrückungsleistungen Langzeitarbeitslose über 60 bei der Deckung des Lebensbedarfes bis zur Pensionierung, wenn die Betroffenen bestimmte Bedingungen erfüllen. Damit soll die Verschlechterung der Altersvorsorge von Betroffenen verhindert werden, die zuvor im Falle von Arbeitslosigkeit ihre AHV-Rente vorbeziehen oder ihr Vermögen oder Pensionsguthaben frühzeitig aufbrauchen mussten, was ein Armutsrisiko im Alter darstellte.
Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens
Die Sozialversicherungsleistungen werden in der Schweiz zu einem grossen Teil über lohnabhängige Beiträge der Erwerbstätigen finanziert. Auch die Höhe der Leistungen, auf welche die versicherten Personen Anspruch haben, bemisst sich oft am Erwerbseinkommen. Dieses beitragsbasierte System kann den Bedürfnissen grosser Teile der Bevölkerung nicht mehr gerecht werden, wenn ein grosser Teil der Bevölkerung keine regelmässige Arbeit ausüben kann, etwa in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit. Ein vieldiskutiertes Alternativmodell stellt das bedingungslose Grundeinkommen dar. 2012 lancierte eine aus Kulturschaffenden hervorgehende zivilgesellschaftliche Gruppe die Volksinitiative «für ein bedingungsloses Grundeinkommen». Sie forderte für alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger ein Einkommen, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung erbringen müssen. Die Initianten und Initiantinnen argumentierten, dass die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme stark eingeschränkt oder ganz aufgehoben werden könnten. Der Verwaltungsaufwand für die Sozialversicherungen könnte reduziert werden. Menschen in Armut hätten weniger Existenzängste und würden von der Sozialhilfe oder der Arbeitslosenversicherung nicht mehr kontrolliert. Eine Existenzsicherung fördere zudem kreative und ehrenamtliche Arbeit. Umstritten am bedingungslosen Grundeinkommen war vor allem die Finanzierung und die Belastung für das Steuersystem. Dies ist einer der Gründe, wieso die Volksinitiative 2016 an der Urne klar scheiterte. Die Idee des Grundeinkommens wird nicht nur in der Schweiz diskutiert. Noch weitgehend unbekannt ist, wie sich ein Grundeinkommen auf das Verhalten der Bevölkerung auswirkt. Um dies herauszufinden, testete Finnland als erstes europäisches Land für 2017 und 2018 ein bedingungsloses Grundeinkommen an 2000 Versuchspersonen. Die Ergebnisse der Studie waren jedoch wenig aussagekräftig. Die Versuchspersonen fühlten sich zwar psychisch besser, der Zugang zum Arbeitsmarkt blieb aber für einige Bevölkerungsgruppen unverändert schwierig.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Matter Sonja (2011), Der Armut auf den Leib rücken. Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900-1960), Bern; Schnegg Brigitte (2007), Armutsbekämpfung durch Sozialreform: Gesellschaftlicher Wandel und sozialpolitische Modernisierung Ende des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Stadt Bern. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 69, 233–258; Tabin Jean-Pierre, Merrien François-Xavier (2012), Regards croisés sur la pauvreté, Lausanne ; Tabin Jean-Pierre, Frauenfelder Arnaud, et al. (2010 [2008]), Temps d’assistance. L’assistance publique en Suisse romande de la fin du XIXe siècle à nos jours Lausanne. HLS / DHS / DSS: Fürsorge; Armut.
(07/2024)