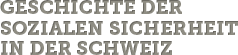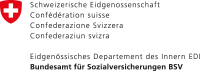Unternavigation
Behinderungen
Körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen sind häufig. In der Schweiz haben heute mehr als 10 Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter eine Behinderung, durch ein Geburtsgebrechen, einen Unfall oder eine Krankheit. Die Definition von und der Umgang mit Behinderungen haben sich historisch stark gewandelt. In der Geschichte des schweizerischen Sozialstaats standen Menschen mit Behinderungen lange Zeit im Schatten anderer Risikogruppen. Eine eidgenössische Invalidenversicherung wurde erst 1960 geschaffen.
In der vormodernen Gesellschaft waren körperliche und geistige Beeinträchtigungen sehr präsent. Die medizinische Versorgung war nur rudimentär. Auch leichte Unfälle oder Krankheiten hatten oft sichtbare und dauerhafte Folgen für die Gesundheit. Menschen mit Behinderungen wurden vor allem dann als Problem wahrgenommen, wenn sie arm und unterstützungsbedürftig waren. Die Obrigkeit erlaubte solchen Armen zu betteln oder brachte sie in Hospitälern oder Pflegefamilien unter. Im 19. Jahrhundert entstanden spezialisierte Anstalten für Menschen mit geistigen Behinderungen, Blinde oder Taubstumme. Behinderung wurde damit zu einem medizinischen oder erzieherischen Problem. Auftrieb erhielt der Rehabilitationsgedanke auch durch die Fortschritte der Medizin, etwa bei der Bekämpfung des Kropfs, und die Entstehung neuer Disziplinen wie der Orthopädie oder der Heilpädagogik. Mit der Verankerung der Schulpflicht in der Bundesverfassung (1874) erhielten auch Kinder mit einer Behinderung Anspruch auf Bildung. Zur Entlastung der Grundschule entstanden vielerorts Hilfsklassen, die lernschwächere Kinder förderten.
Lückenhafte Vorsorge
Die erste Sozialversicherung, die sich dem Invaliditätsrisiko annahm, war die Unfallversicherung. Im 19. Jahrhundert gingen immer mehr Männer und Frauen einer Lohnarbeit nach. Wer nicht mehr arbeiten konnte, war häufig unmittelbar in seiner Existenz bedroht. Die Arbeit in den Fabriken brachte neue Unfallgefahren. Auf Druck bürgerlicher Sozialreformer und der Arbeiterbewegung verbesserten die frühen Fabrikgesetze zwar die Arbeitssicherheit, die Haftpflicht der Unternehmer blieb jedoch begrenzt. Auch nach Erlass des eidgenössischen Fabrikgesetzes (1877) mussten verunfallte Arbeiterinnen und Arbeiter vor Gericht klagen, um eine Entschädigung zu erhalten. An vielen Orten entstanden deshalb freiwillige Hilfskassen, die Erwerbstätige gegen Unfallfolgen versicherten. Zu den versicherten Risiken gehörten nicht nur die vorübergehenden Unfallfolgen, sondern auch die Invalidität. Wer einer Unfallversicherung angehörte, besass im Invaliditätsfall meist ein Anrecht auf eine Rente oder eine Abfindungssumme.
Der doppelte Schutz vor Unfallfolgen und Invalidität fand auch Eingang in die 1918 eingeführte staatliche Unfallversicherung. Gemäss dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG) hatte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) nicht nur für die Behandlungs- und Rehabilitationskosten sowie den Lohnausfall aufzukommen. Bei dauerhafter (Teil-)Erwerbsunfähigkeit hatten die Versicherten auch Anspruch auf eine Invalidenrente. Versichert waren die Folgen von Berufsunfällen und anerkannten Berufskrankheiten wie Vergiftungen in der chemischen Industrie. Die Rentenhöhe wurde in Abhängigkeit vom Verdienstausfall festgesetzt. Ebenfalls gegen Invalidität versichert waren Wehrmänner, die ab 1902 Anspruch auf (durch Steuern finanzierte) Leistungen der Militärversicherung hatten. Auch Pensionskassen begannen, Invalidenrenten auszurichten, zunächst vor allem im öffentlichen, später auch im privaten Sektor.
Die Reichweite dieser Versicherungen blieb indes beschränkt. Nur ein Teil der Beschäftigten - vor allem Arbeiter in der Industrie - war überhaupt bei der Suva versichert. Nicht unter das Obligatorium in der Unfallversicherung fielen der Dienstleistungsbereich, die Landwirtschaft oder Selbstständige. Der Beitritt zu einer Pensionskasse war abhängig vom jeweiligen Arbeitgeber, der Abschluss einer Lebensversicherung gänzlich freiwillig. 1941 waren weniger als ein Sechstel der Erwerbstätigen bei einer Pensionskasse gegen Invaliditätsrisiken versichert. Zudem blieben alle Versicherungslösungen auf Erwerbstätige beschränkt. Denn im Sprachgebrauch der Versicherung war Invalidität gleichbedeutend mit Erwerbsunfähigkeit; Beeinträchtigungen, die keine Lohnreduktion zur Folge hatten, spielten keine Rolle. Keinen Anspruch auf Leistungen hatten deshalb nicht erwerbstätige Personen, insbesondere Hausfrauen oder viele Personen mit einem Geburtsgebrechen. Die Arbeiterbewegung, aber auch linksfreisinnige Kreise forderten deshalb vor dem Ersten Weltkrieg eine Invalidenversicherung (IV), die den Kreis der Versicherten auf die ganze Bevölkerung ausweitete. Bis 1919 führte jedoch nur der Kanton Glarus eine solche Versicherung ein. Erst mit dem sozialpolitischen Aufbruch nach dem Krieg kam die IV auf die politische Agenda. In diesem Zeitraum führten anderen Staaten wie Frankreich Versicherungen für die vielen Kriegsgeschädigten ein. In der Schweiz war zunächst vorgesehen, die IV gleichzeitig mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) einzuführen. Der 1925 angenommene Verfassungsartikel räumte schliesslich der AHV Priorität ein. Als 1931 das erste AHV-Gesetz abgelehnt wurde, schoben die Behörden die Realisierung der IV auf die lange Bank.
Dies hatte zur Folge, dass viele Menschen mit Behinderungen weiterhin von der Armenhilfe abhängig waren. Auf nationaler Ebene prägten in der Zwischenkriegszeit vor allem die Fachverbände der Behindertenhilfe und Exponenten der Heilpädagogik die Behindertenpolitik. 1920 gründeten Vertreter des Sonderschul-, Blinden- und Gehörlosenwesens die Schweizerische Vereinigung für Anormale, die seit 1935 unter dem Namen Pro Infirmis auftritt. Ähnlich wie in der Kranken- oder Arbeitslosenversicherung kam es zu einer engen Kooperation von staatlichen und privaten Akteuren. 1923 begann der Bund, Subventionen an die Pro Infirmis auszurichten, die vor allem für Verbesserungen im Heimsektor eingesetzt wurden. Bis in die Nachkriegszeit trat die Pro Infirmis zudem für eine prophylaktische Behindertenpolitik ein, die auch auf eugenische Massnahmen setzte. Unter Psychiatern und Heilpädagogen bestand Einigkeit, dass vor allem Frauen mit einer geistigen Behinderung, aber auch Gehörlose und Blinde daran gehindert werden sollten, Kinder zu bekommen und ihre Gebrechen an die Nachfahren weiter zu geben. Massnahmen zur Geburtenkontrolle wie Sterilisationen oder Eheverbote galten zudem als probate Mittel, die Sozialausgaben der Gemeinden und Kantonen einzudämmen. 2005 setzte der Bund ein Sterilisationsgesetz in Kraft. Eine Sterilisation bei dauernd urteilsunfähigen Menschen war nun nur noch in Ausnahmefällen und unter strengen Voraussetzungen durchführbar.
Invalidenversicherung: Eingliederung statt Rente
Nach der Einführung der AHV (1948) wurde die IV wieder aktuell. Ihre Realisierung galt, nicht zuletzt mit Blick auf das Ausland, als zunehmend dringlich. Schätzungen gingen davon aus, dass 1950 in der Schweiz 39.000 Männer und Frauen mit einer körpelichen und mindestens 18.000 Personen mit einer geistigen Behinderung lebten. Von den Personen mit körperlichen Einschränkungen im Erwerbsalter waren zwei Drittel ganz oder teilweise erwerbsunfähig. Nur ein Teil bezog eine Rente, viele waren von der Fürsorge abhängig. Gerade Gemeinden setzten sich deshalb für eine rasche Realisierung der IV ein. Nachdem einzelne Stände kantonale Versicherungen eingerichtet hatten und zwei Volksinitiativen Druck machten (1954/55), beschleunigte der Bundesrat die Vorbereitungsarbeiten. 1959 verabschiedete das Parlament das IV-Gesetz, im Jahr darauf konnte der neue Versicherungszweig seine Tätigkeit aufnehmen.
Die IV übernahm das Beitrags- und Rentensystem der AHV. Sie war als Versicherung für die ganze Bevölkerung konzipiert und schloss auch Personen mit geistigen Beeinträchtigungen und Geburtsgebrechen ein. Eine universalistische Invalidenversicherung war im internationalen Vergleich eine schweizerische Eigenheit. In vielen anderen europäischen Ländern gab es Überschneidungen mit anderen Sozialversicherungen. So war in Deutschland die Absicherung des Behindertenrisikos zwischen Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung aufgeteilt. Grund war, dass in Deutschland die gesetzliche Rentenversicherung nicht nur der Altersvorsorge diente, sondern auch das Risiko der verminderten Erwerbsfähigkeit deckte. Auch in Italien entschädigten sowohl die Renten- und Unfallversicherung wie auch die öffentliche Sozialhilfe Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen. In den Niederlanden waren Menschen mit Behinderungen bis in die 1990er Jahre lediglich im Rahmen der autonomen betrieblichen Arbeitnehmerversicherung versichert.
Auf Leistungsseiten sah die IV Massnahmen zur medizinischen und beruflichen Eingliederung, die Abgabe von Hilfsmitteln sowie Taggelder, Renten sowie Beiträge an Institutionen und Sonderschulen vor. Die Renten wurden nach dem Invaliditätsgrad abgestuft. Die IV ging vom Grundsatz "Eingliederung vor Rente" aus: Männer und Frauen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollten nach Möglichkeit in den Arbeitsmarkt integriert werden. Nebst der Militärversicherung war die IV damals die einzige Sozialversicherung, die Massnahmen zur beruflichen Eingliederung kannte. Die Suva beschränkte ihre Leistungen damals auf die medizinische Rehabilitation. Die IV arbeitete dagegen eng mit Behindertenwerkstätten und Berufsberatungsstellen zusammen. Die Behörden erwarteten von einer forcierten Eingliederung nicht nur finanzielle Einsparungen, sondern auch eine erhöhte Selbständigkeit und Erwerbstätigkeit von Menschen mit Behinderungen. Einem geregelten Erwerb nachzugehen, hatte vor allem für Männer immer auch eine hohe symbolische Bedeutung. Erwerbsarbeit stand für eine geordnete Biographie, bot Zugang zu sozialen Netzwerken und vermittelte gesellschaftliche Anerkennung.
Für die Privatwirtschaft war die Mitwirkung bei beruflichen Eingliederungen ein freiwilliges Engagement. Länder wie Grossbritannien oder Deutschland, die eine grosse Zahl von Kriegsversehrten zählten, verpflichteten dagegen einzelne Betriebe, Menschen mit Behinderungen einzustellen. In der Schweiz hatten solche Zwangsmassnahmen politisch keine Chancen. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde das Modell auf der Basis von Freiwilligkeit auch nicht weiter problematisiert. Der Mangel an Arbeitskräften, der in der Hochkonjunktur herrschte, machte Menschen mit (leichten) Behinderungen zu begehrten Beschäftigten.
Die bescheidenen Leistungen der IV wurden in der Folge wiederholt ausgebaut. Zum einen profitierten die IV-Rentnerinnen und -Rentner von der Einführung der Ergänzungsleistungen (1966), dem steigenden Leistungsniveau der AHV und der Indexierung der Renten. Viele Erwerbstätige wurden durch den Ausbau der Unfallversicherung (1984) und der beruflichen Vorsorge (1985) zusätzlich abgesichert. Wie die AHV hatte die IV in solchen Fällen die Funktion einer Basisversicherung, deren Leistungen bei einer Überversicherung gekürzt wurden. Auf der anderen Seite brachten mehrere IV-Revisionen spezifische Leistungserweiterungen. So wurden die Eingliederungsmassnahmen erweitert, die Beiträge für Hilfsmittel und Sonderschulen erhöht (1967), Viertelrenten eingeführt (1986), das System der Hilflosenentschädigung umgestaltet (2003) und ein Assistenzbudget für Menschen mit Behinderungen eingeführt (2006/2012).
Nachdem sie die Rezession der 1970er-Jahre relativ gut überstanden hatte, geriet die IV in den 1990er-Jahren in eine finanzielle Krise. Vor dem Hintergrund der steigenden Arbeitslosigkeit und dem Verzicht auf weitere Beitragserhöhungen nahmen die Zahl der Neurenten und die Defizite stark zu. Auf politischer Ebene entzündete sich eine Missbrauchsdebatte, wobei vor allem Rentnerinnen und Rentner mit psychischen Beeinträchtigungen im Fokus standen. Der IV wurde vorgeworfen, Missbrauch zu fördern und falsche Anreize zu setzen. Der Bundesrat und die bürgerliche Parlamentsmehrheit reagierten darauf mit verschiedenen Sparvorlagen (1999, 2003, 2006), die zum Teil jedoch an der Urne scheiterten. Parallel dazu wurden neue Finanzierungsquellen erschlossen: die Erhöhung der Lohnabzüge (1995), ein zweimaliger Kapitaltransfer von der Erwerbsersatzordnung (1995, 2003) und eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer (2009). Über den Abbau von Leistungen hinaus verstärkte die 5. IV-Revision (2006) schliesslich den Grundsatz "Eingliederung vor Rente", indem sie den aus der Arbeitslosenversicherung bekannten Leitgedanken der Aktivierung adaptierte. Massnahmen der Früherkennung und Frühintervention sowie Verbesserungen der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sollten verhindern, dass gesundheitlich beeinträchtigte Männer und Frauen aus dem Arbeitsprozess herausfallen und zu Rentenbezügerinnen und -bezügern werden. Die Aktivierungspolitik setzte zudem auf eine zu erbringende Gegenleistung der IV-Bezügerinnen und -Bezüger. So gab es eine Mitwirkungspflicht an den Massnahmen zur beruflichen Eingliederung. Neben der Eingliederung zielte die IV auch auf einen gesenkten Rentenbestand, weshalb die Gesetzesrevision mit einer verschärften Rentenzusprechungspraxis einherging.
Die Sozialversicherungen zielten traditionellerweise darauf, die wirtschaftlichen Folgen von Gesundheitsschäden zu kompensieren. Von Anfang an stand die teilweise Entschädigung des Verdienstausfalls im Zentrum, weshalb vor allem Frauen, aber auch Männer, die nicht erwerbstätig waren oder nicht erwerbstätig sein konnten, keine oder deutlich geringere Leistungsansprüche hatten. Viele Menschen mit Behinderungen standen deshalb lange nicht im Blickfeld der Sozialversicherungen. Einen anderen behindertenpolitischen Ansatz vertritt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), das 2004 in Kraft trat. Es ist darauf ausgerichtet, die Hindernisse zu beseitigen, welche die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen in den Weg legt, sei es in Form von baulichen Zugangsschranken, wirtschaftlichen Benachteiligungen oder Vorurteilen. Es macht die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen zu einer Aufgabe der Gesellschaft. In die gleiche Richtung zielte die von der Schweiz 2014 ratifizierte UNO-Behindertenrechtskonvention. Die UNO-Behindertenrechtskonvention basiert auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und hat zum Ziel, Menschen mit Behinderungen dieselben Rechte wie Menschen ohne Behinderungen zu garantieren. Die Konvention enthält jedoch keine individuell einklagbaren Rechte, die Umsetzung liegt bei den Vertragsstaaten. Mit dem Beitritt bekräftigten Bundesrat und Parlament, Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderungen aktiv zu fördern und Diskriminierungen zu bekämpfen.
Während in der aktivierungspolitischen Ausrichtung der IV hauptsächlich die Eigenverantwortung der Menschen mit Behinderungen im Zentrum steht, zielen das Behindertengleichstellungsgesetz und die UNO-Behindertenrechtskonvention vermehrt auf eine Anpassung des Bedarfes von Menschen mit Behinderungen. Sie möchten weg von einem defizitorientierten Blick auf Behinderungen und verfolgen das Ziel eines selbstbestimmten Lebens und der Inklusion von Menschen mit Behinderungen.
Canonica, Alan (2017): Konventionen der Arbeitsintegration. Die Beschäftigung von Behinderten in Schweizer Unternehmen (1950-1980), Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 62(2), S. 233-255; Fracheboud Virginie (2015), L'introduction de l'assurance invalidité en Suisse (1944–1960): tensions au coeur de l'Etat social, Lausanne; Germann Urs (2008), „Eingliederung vor Rente“. Behindertenpolitische Weichenstellungen und die Einführung der schweizerischen Invalidenversicherung, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 58, S. 178–197; Kaba Mariama (2007), Des reproches d’inutilité au spectre de l’abus: étude diachronique des conceptions du handicap au XIXe siècle à nos jours, Cahiers de bord, 13, 68–77; Wolfisberg Carlo (2002), Heilpädagogik und Eugenik. Zur Geschichte der Heilpädagogik in der deutschsprachigen Schweiz 1800–1950, Zürich. HLS / DHS / HSS: Behinderte; Invalidenversicherung IV.
(12/2018)