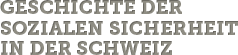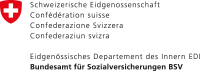Unternavigation
Krankheit
Jeder Mensch ist in seinem Leben verschiedene Male krank. Jeder Einzelne mag unterschiedlich häufig und unterschiedlich stark betroffen sein – aber Kranksein ist für Alle ein alltägliches Risiko. Viele Krankheiten gelten auch als gesellschaftliches Problem. Dies gilt etwa für Infektionskrankheiten wie Cholera, Tuberkulose oder – in jüngster Zeit – AIDS, aber auch für chronische Krankheiten wie Krebs oder Herzkreislauf-Krankheiten. In solchen Fällen ist nicht nur das Leben eines Einzelnen bedroht. Die Gefährdung betrifft hier ganze Gruppen von Menschen; entsprechend gilt die Vorsorge vor diesen Krankheiten auch als politisches Problem. Gesundheit und individuelles Wohlbefinden sind heute gesellschaftliche Güter, deren Gewährleistung im öffentlichen Interesse liegt.
Im Krankheitsfall steht heute meist die medizinische Versorgung im Vordergrund. Sie hat sich in den letzten Jahrhunderten grundlegend gewandelt. Verbesserungen der Hygiene und der Ernährung sowie der medizinische Fortschritt haben dazu beigetragen, dass Krankheiten, die früher tödlich verliefen, heute geheilt werden können. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in der Schweiz zwischen 1880 und 2010 von 40 auf 84 (Frauen) respektive 80 Jahre (Männer) verdoppelt. Ebenfalls gewandelt haben sich die Gesundheitsberufe. Vor 1800 lag die Gesundheitsversorgung nur zu einem geringen Teil in den Händen gelehrter Ärzte. Auch Bader, Chirurgen, Hebammen und andere nicht-akademische Heilkundige kümmerten sich um die Gesundheit der Bevölkerung. Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts entstand der moderne Beruf des Arztes. Seit 1877 ist die Medizinalprüfung gesamtschweizerisch geregelt, wodurch die Monopolstellung der Ärzte weiter ausgebaut wurde. Aus den Spitälern, die zunächst ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen aufnahmen, sind im Lauf des 19. Jahrhunderts moderne Krankenhäuser oder Kliniken geworden. Zusätzlich entstanden Spezialeinrichtungen wie Frauenkliniken, Heil- und Pflegeanstalten für psychisch kranke Menschen oder Lungensanatorien für Tuberkulosekranke. Dabei wurde auch die Pflege, die traditionellerweise als Frauenberuf galt und oft von Ordensschwestern besorgt wurde, professionalisiert, spezialisiert und unter ärztliche Aufsicht gestellt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Entwicklung neuer Medikamente, Operationstechniken und Untersuchungsverfahren zu einer historisch beispiellosen Expansion, Spezialisierung und Technisierung der Medizin geführt. Heute gehört das Gesundheitswesen zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren. In den westlichen Industrienationen fliessen 10 Prozent und mehr des Bruttoinlandproduktes ins Gesundheitswesen.
Neue Formen der Vorsorge: Hilfskassen und Krankenversicherung
Bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert war die Pflege kranker Menschen weitgehend Sache der Familie, die auch für Arzthonorare oder Arzneien aufkommen musste. Bei schweren Krankheitsfällen leisteten allenfalls die Heimatgemeinden Unterstützung. Lange konnten sich deshalb nur wohlhabende Kreise eine professionelle medizinische Versorgung leisten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts führten die Industrialisierung und die Ausbreitung der Lohnarbeit zu einer neuen gesundheitspolitischen Konstellation. Die lohnabhängigen Arbeiterinnen und Arbeiter waren dem Krankheitsrisiko relativ ungeschützt ausgeliefert. Bei einer längeren Krankheit wurde der Lohn in der Regel nicht weiter ausgezahlt. Viele Betroffene verarmten bei einer längeren Krankheit und mussten bei der Gemeinde um Fürsorgeleistungen nachsuchen. Parallel zum Wachstum des Industriesektors gründeten private Vereinigungen, Berufsverbände, Gewerkschaften oder einzelne Unternehmer vielerorts Hilfskassen, die solche Notlagen entschärfen sollten. Die Hilfskassen beruhten auf dem Prinzip der wechselseitigen Solidarität: Die Mitglieder bezahlten Prämien und erhielten dafür im Krankheitsfall ein bescheidenes Taggeld, das sie gegen den Lohnausfall absicherte. Zunächst stand die Kompensation des Lohnausfalls im Vordergrund. Mit der Zeit überahmen die Hilfskassen auch die Erstattung der Behandlungskosten. Die Hilfskassen breiteten sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg stark aus. 1914 waren bereits 10% der Bevölkerung bei einer Krankenkasse versichert, darunter deutlich mehr Männer als Frauen. Aus Sicht der Ärzteschaft wuchs dadurch der Anteil der Kassenpatienten, bei denen sich das Honorar nach den Tarifverträgen mit den Krankenkassen richtete.
Das Deutsche Reich führte 1883 eine neue Form der Risikovorsorge ein, die das Modell der privat getragenen Hilfskasse verallgemeinerte: die soziale Krankenversicherung, die für einen Grossteil der Bevölkerung obligatorisch war. Auch in der Schweiz wurde 1890 eine Verfassungsgrundlage für die Einführung einer obligatorischen Krankenversicherung geschaffen. Die entsprechende Gesetzesvorlage wurde 1900 in einer Volksabstimmung allerdings klar abgelehnt. Damit lehnte die Schweizer Stimmbevölkerung das deutsche Modell einer Pflichtversicherung mit behördlich eingerichteten Krankenkassen und lohnprozentualer Finanzierung mit Arbeitgeberbeteiligung ab. Nach diesem Rückschlag verzichtete das revidierte Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG) von 1912 auf ein allgemeines Obligatorium in der Krankenversicherung.
Der Bund förderte in der Folge den Versicherungsgedanken auf indirektem Weg. Anerkannte Krankenkassen konnten vom Bund Subventionen beantragen. Zudem erlaubte das KUVG Kantonen, auf ihrem Gebiet obligatorische Krankenversicherungen einzuführen. Dies geschah in der Folge in etwa der Hälfte der Kantone. Auch einzelne Städte entschieden sich für ein Obligatorium. Meist waren solche Regelungen auf gefährdete Personengruppen – etwa Kinder oder Geringverdienende – beschränkt. Versichert waren in der Regel nur die Behandlungskosten, nicht der Erwerbsausfall. Theoretisch hätten die Kantone staatliche Krankenkassen gründen können. Fast überall delegierte man die Durchführung der obligatorischen Krankenversicherung jedoch an die zahlreichen bestehenden Kassen, was einer – bis heute anhaltenden – Zersplitterung des Kassenwesens Vorschub leistete. Die Zahl der krankenversicherten Personen nahm nach dem Ersten Weltkrieg langsam, aber stetig zu: 1940 war bereits die Hälfte, 1980 praktisch die ganze Bevölkerung gegen Krankheit versichert. Auch am Ende des 20. Jahrhunderts bestanden indes Versicherungslücken bei der Spitalpflege oder dem Krankentaggeld. Um 1990 war lediglich die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung gegen einen krankheitsbedingten Erwerbsausfall versichert.
Der lange Weg zum Obligatorium
Vorstösse für ein allgemeines Obligatorium in der Krankenversicherung scheiterten im 20. Jahrhundert wiederholt. Während des Zweiten Weltkriegs und unter dem Eindruck des Beveridge-Plans wurden auch in der Schweiz Forderungen nach einer umfassenden nationalen Sozialversicherung (die auch das Krankheitsrisiko abgedeckt hätte) laut. Entsprechende Vorschläge waren politisch jedoch chancenlos. Zu stark waren die föderalistischen und finanzpolitischen Vorbehalte gegenüber einem Ausbau zentralstaatlicher Einrichtungen. Nach dem Kriegsende, als Staaten wie Frankreich oder Grossbritannien ein umfassendes soziales Sicherungssystem einführten, beschränkten die schweizerischen Behörden ihre sozialpolitischen Aktivitäten auf den Ausbau der AHV. Nachdem 1949 die moderate Vorlage der Tuberkuloseversicherung Schiffbruch erlitten hatte, mussten die Pläne für einen Ausbau der Krankenversicherung zurückgestellt werden. In einer weiteren Weichenstellung lehnte das Stimmvolk 1974 sowohl ein nationales Krankenversicherungsobligatorium als auch einen besseren Schutz vor kostspieligen Krankheitsrisiken (wie längere Spitalaufenthalte oder Erwerbsausfälle) ab. Erst 1994 kam das Obligatorium schliesslich zustande. Das neue Krankenversicherungsgesetz (KVG) deckte neu auch die Spitalpflege vollständig ab. Das Krankentaggeld war jedoch nach wie vor nicht obligatorisch versichert, wodurch sich die Schweiz von den meisten europäischen Staaten abhob. Eine zeitlich beschränkte Lohnfortzahlung blieb Sache des Arbeitsrechts und der Gesamtarbeitsverträge. Nicht versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten, sofern sie die Prämien trugen, das Erwerbsausfallsrisiko auch durch freiwillige Zusatzversicherungen abdecken.
Durch die späte Einführung des allgemeinen Obligatoriums in der Krankenversicherung und den grossen Anteil an Direktzahlungen, welche die Krankenversicherten leisten, gleicht die Entwicklung des schweizerischen Gesundheitswesens jenem der Vereinigten Staaten. So dominieren auch in den Vereinigten Staaten private Krankenversicherungen. Das Obligatorium wurde noch später als in der Schweiz eingeführt. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten regulierte das KUVG bereits ab 1912 Leistungen und Finanzierung der Privatversicherer. Staatliche Finanzbeiträge kamen in der Schweiz im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten allen Versicherten einer Krankenkasse zugute und nicht nur bedürftigen Bevölkerungsgruppen. Durch die traditionell bedeutende Rolle privater und zivilgesellschaftlicher Einrichtungen wie Krankenkassen und Hilfsvereinen ist die Schweiz auch mit Deutschland und Frankreich vergleichbar.Während in der Schweiz und Deutschland hauptsächlich die Krankenkassen und letztlich die Versicherten für die Aufbringung der Finanzmittel verantwortlich waren, setzt das Gesundheitssystem Frankreichs oder Grossbritanniens stärker auf fiskalische Beiträge des Staates. Am stärksten unterscheidet sich die Schweiz von zentralisierten Gesundheitssystemen wie etwa dem Britischen National Health Service. Insgesamt zeichnet sich die Schweiz im internationalen Vergleich durch die überaus gewichtige Rolle privater Institutionen und den föderalistischen Charakter des Gesundheitswesens aus. Die Aufsicht der Gesundheitsdienste obliegt den kantonalen Gesundheitsdirektoren, deren Kompetenz jedoch durch das KVG begrenzt wird. Während der Bund die Rahmengesetze erlässt, sind die Kantone für die Ausführungsbestimmungen und den Vollzug verantwortlich. Eine Konsequenz aus diesen Merkmalen sind die kantonal unterschiedlichen Prämienansätze.
Langfristig hatte die Einführung der Krankenversicherung zur Folge, dass sich die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen erhöhte. Vor allem die frühen Versicherungsobligatorien auf kantonaler und städtischer Ebene öffneten geringverdienenden Schichten, die sich bislang nur im Notfall einen Arzt leisten konnten, einen erweiterten Zugang zum Gesundheitswesen. Als Konsequenz stiegen naturgemäss auch die Kosten im Gesundheitswesen. Bereits in der Zwischenkriegszeit kamen Klagen über Kostensteigerungen auf. Die Krankenkassen reagierten mit der Einschränkung ihrer Leistungskataloge und der Verstärkung der Kostenbeteiligung der Versicherten. Zu einer erneuten Kostenexplosion kam es in der Nachkriegszeit durch die rasante medizinisch-technische Entwicklung, die Expansion der Pharmaindustrie und den Ausbau der Spitalversorgung. Allein zwischen 1966 und 1989 stiegen die Ausgaben der Krankenkassen um den Faktor 8.6, während sich die Arbeiterlöhne nur um den Faktor 3.6 und die Konsumentenpreise um den Faktor 2.4 erhöhten.
Bis Mitte der 1960er-Jahre galt die Zunahme der Gesundheitskosten allerdings als Nebeneffekt des wirtschaftlichen Aufschwungs. Der wachsende Wohlstand sollte sich auch in einem modernen Gesundheitswesen spiegeln. Erst mit der Wachstumskrise Mitte der 1970er-Jahre setzten ernsthafte Anstrengungen zur Kosteneindämmung ein. 1977 fror der Bund die Subventionen an die Krankenkassen ein, was die Prämien der Versicherten zusätzlich in die Höhe trieb. Das KVG von 1994 verstärkte diese Entwicklung zusätzlich. Es verankerte die Idee der Kostendämpfung und der Ökonomisierung des Gesundheitswesens im Gesetz. Es sah unter anderem vor, alternative, kostensenkende Versicherungsmodelle zu fördern, die Selbstbeteiligung der Versicherten (Franchise, Selbstbehalt) deutlich zu erhöhen sowie die Kostentransparenz und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung zu verbessern. Diese Massnahmen erwiesen sich allerdings bald als ungenügend. Zudem wurde es zunehmend schwieriger, die Interessen der beteiligten Akteure (Kantone, Krankenkassen, Pharmaindustrie, Ärzte, Spitäler, Patientenorganisationen) politisch unter einen Hut zu bringen. So scheiterten in der Folge verschiedene Vorlagen mit dem Ziel von Kosteneinsparungen. 2010 lehnte das Bundesparlament ein Massnahmenpaket zur Eindämmung der Kosten ab. 2012 erlitt die Managed-Care Vorlage in der Volksabstimmung Schiffbruch. In eine andere Richtung zielten linke Vorstösse, eine öffentliche Einheitskrankenkasse einzurichten. 2014 wurde diese Idee jedoch an der Urne verworfen. 2013 stellte der Bundesrat das Massnahmenpaket «Gesundheit2020» vor, das auf eine bessere Versorgung älterer Menschen, die Stärkung der Prävention und die Einführung transparenterer und besser steuerbarer Strukturen im Gesundheitswesen zielt. Die Gesundheitskosten zu stabilisieren, ohne substanzielle Leistungseinbussen zu riskieren, bleibt weiterhin die zentrale Herausforderung der sozialen Krankenversicherung.
Pandemien
Infektionskrankheiten verbreiten sich häufig in Epidemien. Sie treten dabei in regelmässigen zeitlichen Abständen und in lokal gehäufter Anzahl auf. Verbreitet sich eine Epidemie weltweit und bedroht einen grossen Teil der Weltbevölkerung, spricht man von einer Pandemie.
Als klassische Pandemien gelten die Grippewellen, die sich aufgrund der grossen Ansteckungskraft des Grippevirus alle zehn bis fünfzehn Jahre über verschiedene Länder und Kontinente ausbreiten. Die grösste Pandemie der Neuzeit war die Spanische Grippe, die in der Schweiz in zwei Wellen zwischen Juli 1918 und Juni 1919 über 24'000 Todesopfer forderte. Der Name hängt mit den ersten Berichten über das Auftreten der Pandemie zusammen, die aus Spanien stammten. Heute nimmt man an, dass die Krankheit asiatischen Ursprungs war und vermutlich über US-Soldaten während des Ersten Weltkriegs nach Europa gebracht wurde. Die Spanische Grippe forderte weltweit mehr Opfer als der Erste Weltkrieg. Schätzungen gehen von 20 bis 50 Millionen Toten aus. Die Krankheit nahm einen oft raschen Verlauf und betraf vor allem jüngere Leute zwischen 20 und 40 Jahren.
In der Schweiz erkrankte vermutlich die Hälfte der Bevölkerung an der Spanischen Grippe. Die zweite Welle im Oktober und November 1918 forderte deutlich mehr Opfer als die erste. In diesen Wochen wurde die Schweiz von heftigen sozialen Unruhen, insbesondere vom Landesstreik im November 1918, erschüttert. Die Grippe verschärfte die sozialen Ungleichheiten noch. Besonders betroffen waren Arbeiterquartiere und Soldatenkasernen. Trotz der Grippewellen wurden Streiks durchgeführt und militärische Truppen gegen die Streikenden aufgeboten. Die Behörden standen dem Seuchengeschehen weitgehend machtlos gegenüber oder unterschätzten die Gefahr. Der Bundesrat forderte die Kantone bereits im Juli 1918 auf, Massnahmen gegen die Pandemie zu ergreifen. Trotzdem gab es kein einheitliches Vorgehen. Kantone und Gemeinden waren ermächtigt, kulturelle und religiöse Veranstaltungen abzusagen und grössere Versammlungen aufzulösen. Die Bevölkerung empfand die behördlichen Aufrufe und Verbote jedoch oft als Schikane. Obwohl die Spanische Grippe vor allem die Zivilbevölkerung betraf und nur acht Prozent der Todesopfer Militärdienstleistende waren, erinnerte sich die Schweiz im Nachgang der Pandemie vor allem an die toten Soldaten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1946 ein internationales Grippeüberwachungssystem ein, das Pandemien im Ausmass der Spanischen Grippe künftig verhindern sollte. Die medizinischen Fortschritte des 20. Jahrhunderts, namentlich die Entwicklung von Antibiotika und von antiviralen Medikamenten und Schutzimpfungen, führten dazu, dass Epidemien in der Schweiz wirksamer bekämpft werden konnten und zunehmend noch lokal begrenzt auftraten. Trotzdem kam es vereinzelt noch zu Grippepandemien, so etwa 1957, 1968 und 2009. Ab 1983 entwickelte sich zudem das HI-Virus zu einer Pandemie und verursachte die AIDS-Krise der 1980er- und 1990er-Jahre. Seit Ende 2019 verbreitete sich schliesslich das Covid-19-Virus weltweit. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Krise belasteten auch verschiedene Bereiche des Sozialstaats, insbesondere das Gesundheitswesen und die Arbeitslosenversicherung.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin, Rothenbühler Verena (2004), Macht und Ohnmacht der Ärzteschaft. Geschichte des Zürcher Ärzteverbands im 20. Jahrhundert, Zürich; Alber Jens, Bernardi-Schenkluhn, Brigitte (1992), Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich. Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Frankfurt am Main 1992; Grossmann Stefanie (2021), Pest, Spanische Grippe, Corona: Seuchen und ihre Bekämpfung, NDR, 11, https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Pest-Spanische-Grippe-Corona-Seuchen-und-ihre-Bekaempfung,seuchenbekaempfung100.html, Stand: 19.02.2021; HLS: Epidemien, Grippe; Kury Patrick (o. D.), Die Jahrhundertgrippe von 1918/19 in Zeiten von Corona, Stadt Geschichten Basel, https://www.stadtgeschichtebasel.ch/index.html, Stand: 24.02.2021; O. A. (20.12.2018), Infektionskrankheiten: Ausbrüche, Epidemien, Pandemien, Bundesamt für Gesundheit BAG, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien.html, Stand: 19.02.2021; O. A. (20.07.2018), Vergangene Epidemien und Pandemien, Bundesamt für Gesundheit BAG, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/vergangene-epidemien-pandemien.html, Stand: 24.02.2021; O. A. (08.05.2020), Was Corona mit der „Spanischen Grippe“ verbindet – und was nicht, News Universität Basel; Vögele Jörg (2016), Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive, Wiesbaden. HLS / DHS / DSS: Krankenversicherung; Gesundheitswesen.
(06/2021)