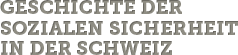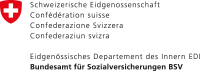Unternavigation
Spitäler
Ab dem Mittelalter sind Spitäler karitative Fürsorgeeinrichtungen für Bedürftige aller Art. Im 19. und 20. Jahrhundert entwickeln sie sich zu Krankenhäusern und nehmen eine immer wichtigere Funktion im Sozialstaat ein.
Hospitäler im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit richteten sich Spitäler nicht nur an pflegebedürftige Patientinnen und Patienten. Sie dienten allgemein der Versorgung von einheimischen und auswärtigen Bedürftigen. Darunter befanden sich nicht nur kranke, sondern auch altersschwache oder arme Bürgerinnen und Bürger, die nicht von ihren Angehörigen versorgt werden konnten, daneben auch Reisende und Pilger. Spitäler hatten den Charakter von Versorgungsanstalten für mittellose und marginalisierte Personen. Betrieben wurden sie ursprünglich von Kirchen oder Klöstern. Ab 1300 übernahmen vielerorts die Gemeinden und Städte die Verwaltung der Spitäler, wobei die Einrichtungen oft weiterhin von geistlichem Personal betreut wurden. Die Spitäler besassen häufig Ländereien, profitierten in den protestantischen Regionen von der Säkularisation der Kirchengüter und erhielten im 17. und 18. Jahrhundert Zuwendungen aus der Oberschicht. Im 18. Jahrhundert bauten viele Städte neue Spitäler oder renovierten bereits bestehende. Dabei wurden die verschiedenen Gruppen von Bedürftigen – Männer und Frauen, Gesunde und Kranke – räumlich zunehmend getrennt. In katholischen Spitälern übernahmen oftmals Angehörige von Ordensgemeinschaften die Betreuung der Kranken.
Krankenhäuser in der Anstaltslandschaft des 19. Jahrhunderts
Die Spitäler blieben bis ins 19. Jahrhundert Fürsorgeeinrichtungen für alte, bedürftige und kranke Menschen sowie für Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wuchs der Heim- und Anstaltssektor stark an. Geprägt von bürgerlichen Reformdebatten wurden zunehmend spezialisierte Einrichtungen für einzelne Bedürftigengruppen errichtet. Die spezialisierten Anstalten entsprachen dem Bedürfnis nach Pflege und Betreuung der Betroffenen ebenso wie dem Kontrollbedürfnis der öffentlichen Ordnung.
Das Spitalwesen blieb in dieser Entwicklung für die pflegebedürftigen Kranken zuständig. Parallel zu den Bürgerspitälern entstanden Kliniken, die von Universitäten Betrieben wurden und hauptsächlich dazu dienten, Medizinstudenten auszubilden. In Kliniken lag die Behandlung der Patienten ausdrücklich in ärztlicher Verantwortung. Die Diagnostik und Therapien, die hier erprobt wurden, setzten neue Massstäbe für die Gesamtheit der Spitäler. Sie spezialisierten sich als „Krankenhäuser“, führten feste Spitalärzte ein und verbesserten ihre Diagnostik und die Pflege- und Heilmethoden. Spezialdisziplinen wie die Chirurgie machten grosse Fortschritte. Innerhalb der Spitäler setzte sich die räumliche Differenzierung fort, indem die Räumlichkeiten in funktionale Abteilungen unterteilt wurden. Seit den 1830er-Jahren wurden in ländlichen Gebieten Spitäler errichtet, um auch hier einer wachsenden Nachfrage zu entsprechen. Damit griffen erstmals die Kantone ins Spitalwesen ein.
Spitäler im Sozialstaat
Trotz dieser Entwicklungen hatten Spitäler noch im frühen 20. Jahrhundert ein geringes Prestige als karitative Einrichtungen, die sich vor allem an eine verarmte Klientel richteten. Wer sich einen hausärztlichen Beistand leisten konnte, ging nicht ins Spital. Viele Spitäler waren finanziell weiterhin von privaten Zuwendungen abhängig.
Ab 1914, mit der teilweisen Einführung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, änderte sich die Finanzierungsgrundlage der Spitäler schrittweise. Weil der Bund das Krankenkassenwesen durch Subventionen förderte, erhielten Versicherungsbeiträge innerhalb der Spitalfinanzierung eine zunehmende Bedeutung. Dies war ein langwieriger Prozess, da die Krankenversicherung auf nationaler Ebene und in den meisten Kantonen fakultativ blieb und sich deshalb nur langsam ausbreitete (bis 1945 waren nur ca. 50% der Bevölkerung versichert).
In der Zwischenkriegszeit änderte sich auch die Zusammensetzung des Spitalpersonals: Assistenzärzte in Ausbildung hielten verstärkt Einzug. Auch die Ausbildung der Pflegerinnen und Pfleger wurde durch Fachschulen professionalisiert. Gleichzeitig wurden die geistlichen Schwestern zunehmend verdrängt.
Seit den 1950er-Jahren rüsteten die Kantone in der Hochkonjunktur ihre Spitäler technisch auf und gründeten weitere Regional- und Bezirksspitäler. Neue Heilmethoden und Medikamente kamen zur Anwendung. Die Anzahl der Spitalbetten und die Patiententage stiegen nur schwach an, aber die Häufigkeit der Spitalbesuche nahm stark zu, während die Verweildauer zurückging. Auch die Ärzteschaft profitierte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vom beschleunigten Ausbau des Gesundheitswesens. Vor allem die Gruppe der angestellten Ärztinnen und Ärzte, die in den Spitälern arbeitete, nahm stark zu gegenüber der etwas langsamer wachsenden Gruppe der freipraktizierenden Hausärzte.
Aufgrund dieser Entwicklungen stiegen die Spitalkosten stark an. Am stärksten ins Gewicht fielen die Innovationen im Bereich der Apparaturen und Medikamente. Die Kosten wurden von der öffentlichen Hand und den Patienten getragen, von denen immer mehr von einer Krankenversicherung profitierten. Die Versicherungsdichte erhöhte sich von rund 50% um 1945 auf bereits 80% um 1960. Obwohl die Kantone die grössten Geldgeber waren, zwangen sie die Spitäler nicht, ihre Leistungen zu koordinieren oder den Spitalbetrieb zu rationalisieren. Die Expansion des Spitalwesens war trotz zunehmender Kosten politisch unumstritten. Die Wohlstandsgewinne der Hochkonjunktur in eine bessere Qualität des Gesundheitswesen zu investieren war in einer breiteren Bevölkerung populär. Der Bund regelte 1964 die Finanzierung der Gesundheitskosten neu, indem er die Bundessubventionen an die Krankenkassen mit deren Ausgabenentwicklung koppelte. Dies hatte zur Folge, dass die Spitäler und die Krankenkassen die Leistungen in der Grundversicherung erweiterten.
Spitalreformen seit den 1970er Jahren
Die Rezession von 1974/75 markierte das Ende der aussergewöhnlich langen Hochkonjunktur. In der Folge wurden die Spital- und Gesundheitskosten zunehmend kritisch betrachtet. Als Folge ergriffen die Kantone Massnahmen, um den Anstieg der Kosten zu begrenzen. Sie nahmen eine Restrukturierung der Spitalinfrastruktur vor, um Doppelspurigkeiten abzuschaffen. Listen bestimmen seit 1996, in welchen Spitälern die Patienten auf Kosten der obligatorischen Versicherung behandelt werden dürfen. Obwohl sich die betroffene Bevölkerung vielerorts gegen die Schliessung ihrer Spitäler wehrte, sank die Zahl der allgemeinen Krankenhäusern und Spezialkliniken ab 1998 von 378 auf 289 im Jahr 2014. Im gleichen Zeitraum verschwanden rund 20 Prozent der Spitalbetten.
Weitere Anstrengungen zur Dämpfung des Kostenanstiegs setzten auf eine Ökonomisierung der Spitäler. Eine neue Spitalfinanzierung sollte dafür sorgen, dass die vorhandenen Ressourcen sparsamer eingesetzt werden und die Spitäler miteinander in Wettbewerb treten. Finanziert werden seit 2012 nicht mehr die Spitäler selbst, sondern mittels „Fallpauschalen“ die Leistungen, die sie erbringen. Die Höhe der jeweiligen Pauschale hängt von der Diagnose und der Behandlung ab, der sich eine Patientin oder ein Patient unterziehen muss. Fallen Therapiekosten in den Bereich der Grundversicherung, werden sie zu höchstens 45 Prozent von den Versicherungen und zu mindestens 55 Prozent von der öffentlichen Hand getragen. Zehn Prozent der Fallpauschalen sind dazu bestimmt, die Investitionskosten der Spitäler zu decken. Zudem verpflichteten sich die Kantone 2009 dazu, die Spitzenmedizin (hochspezialisierte Abteilungen) über die Kantonsgrenzen hinweg zu koordinieren.
Ob die Massnahmen wirklich kostendämpfende Wirkung haben und welche weiteren Effekte davon ausgehen, lässt sich im Moment noch schwer beurteilen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Donzé Pierre-Yves (2003), Bâtir, gérer, soigner: Histoire des établissements hospitaliers de Suisse romande, Genève ; Gilomen-Schenkel Elsanne (1999), Mittelalterliche Spitäler und Leprosorien im Gebiet der Schweiz, in Stadt- und Landmauern 3, 117-124 ; Lengwiler Martin, Rothenbühler Verena (2004), Macht und Ohnmacht der Ärzteschaft: Geschichte des Zürcher Ärzteverbands im 20. Jahrhundert, Zürich ; HLS / DHS / DSS: Spital
(12/2016)