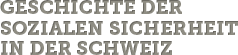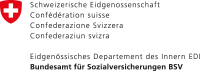Unternavigation
Krankenkassen
Die Krankenkassen gehören zu den einflussreichsten sozialpolitischen Akteuren. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wehren sie sich erfolgreich gegen zentralistische Sozialstaatsprojekte. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass sich die Krankenversicherung in der Schweiz lange in privatwirtschaftlichen Bahnen entwickelte.
Die Geschichte der Krankenkassen geht in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Parallel zur Industrialisierung gründeten Unternehmer, Berufsverbände oder Gemeindebehörden zahlreiche kleine Hilfskassen mit lokalem oder regionalem Fokus. Diese boten einen minimalen Schutz gegen Kranken-, Invaliditäts- oder Todesfallrisiken und breiteten sich ab den 1860er-Jahren schnell aus. Parallel dazu wuchs ihre Durchschnittsgrösse. 1865 existierten schweizweit 632 Kassen mit einer durchschnittlichen Mitgliederzahl von 150 Personen. Ende der 1880er-Jahre waren es bereits über 1000 Kassen mit durchschnittlich 200 Mitgliedern. Versichert waren weniger als fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. In industrialisierten Regionen wie den Kantonen Glarus, Zürich oder Basel-Stadt stieg der Versicherungsgrad auf bis zu einem Viertel der Bevölkerung. Seit den 1890er-Jahren spezialisierte sich eine steigende Anzahl Kassen auf den Bereich der Krankenversicherung. Dies war die Geburtsstunde der Krankenkassen in ihrer heutigen Form.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert war die Krankenkassen-Landschaft höchst vielfältig. Viele Kassen beschränkten sich auf einen bestimmten Mitgliederkreis: gewerkschaftliche Kassen auf bestimmte Berufsangehörige, unternehmerische Kassen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebs, kommunale und regionale Kassen auf Einwohnerinnen und Einwohner einer Ortschaft oder einer Gegend, katholische Kassen auf die Angehörigen katholischer Milieus. In diesen Kassen stand der Gedanke einer genossenschaftlichen Vereinigung unter Gleichgesinnten im Vordergrund. Nur wenige Kassen waren überregional oder national organisiert. Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts kam es zu einem Konzentrationsprozess, in dessen Folge sich grössere und zunehmend überregionale Krankenkassen bildeten, die sich stärker als kommerzielle Versicherungsunternehmen verstanden.
Mehr als die Hälfte aller Krankenkassen beschränkten sich um 1900 auf Lohnentschädigungen. Ärztliche Behandlungen mussten von den Arbeiterinnen und Arbeitern meist selber bezahlt werden. Das Wechseln zwischen zwei Kassen war schwierig. Viele Kassen auferlegten hohe Beitrittshürden und es fehlte an Freizügigkeitsregeln. Um diesen Mangel zu beheben, schlossen sich seit Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Krankenkassen zu regionalen oder kantonalen Verbänden zusammen, die wiederum nationale Konkordate begründeten (1891 das deutschschweizerisch verankerte Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen, KSK; 1893 die Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande, 1921 die Federazione ticinese delle casse malati, die sich beide 1985 mit dem KSK – seit 2002 santésuisse – vereinigten).
Seit 1900 übten die Krankenkassen einen steigenden Einfluss auf die ärztlichen Einkommen aus. Vielerorts wurden kollektive Tarifverträge zwischen Krankenkassen und Ärztegesellschaften abgeschlossen, mit denen die beiden Parteien die Honoraransätze für ärztliche Leistungen regelten.
Gegenüber den nationalen Bestrebungen zur Einführung einer staatlichen Krankenversicherungspflicht blieben viele Krankenkassen skeptisch. Sie befürchteten, durch die staatliche Regulierung ihre Autonomie zu verlieren. Teilweise kamen föderalistische Vorbehalte gegenüber zentralstaatlichen Einrichtungen hinzu. Die Opposition aus Hilfskassenkreisen trug mit dazu bei, dass das erste Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG) 1900 in der Volksabstimmung eine klare Niederlage erlitt. Infolgedessen beschränkte sich das revidierte KUVG von 1912 darauf, jenen Kantonen und Gemeinden Bundessubventionen zuzugestehen, die für ihr Gebiet eine obligatorische Krankenversicherung errichteten.
Dieser Entscheid war weichenstellend für die Entwicklung der Krankenkassen. Die Krankenversicherung blieb für die nächsten Jahrzehnte überwiegend privatrechtlich begründet. Zwar erliessen verschiedene Kantone Gesetze für obligatorische Pflichtversicherungen, zunächst der Kanton Basel-Stadt (1914), bis Ende der 1920er-Jahre knapp die Hälfte aller Kantone. Allerdings erfassten die Obligatorien meist nur die Geringverdienenden. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung blieb privat versichert oder verzichtete ganz auf eine Krankenversicherung. Letztlich profitierten die Krankenkassen vom Obligatoriumstrend. Sie wehrten sich erfolgreich gegen die Gründung staatlicher Kassen. Nur in Ausnahmefällen, etwa in Basel-Stadt, kam es soweit. Meistens blieb auch das Obligatorium den privaten Kassen vorbehalten. Nach dieser ersten Ausbauphase erreichte die Krankenversicherung bis 1935 immerhin fast die Hälfte der Bevölkerung.
Mit dem Aufschwung der Krankenkassen verschob sich das Machtverhältnis zwischen Ärztegesellschaften und Kassenverbänden zunehmend zugunsten der Letzteren. Während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre brachen heftige Tarifkonflikte aus, die sich bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinzogen. Während der Kriegsjahre debattierten Ärzteschaft und Krankenkassen zudem grundlegende Reformen des Gesundheitswesens. Dies geschah nicht zuletzt unter dem Eindruck des 1942 veröffentlichten Beveridge-Berichts, der einen beträchtlichen Ausbau des britischen Sozialstaats verlangte und international breit beachtet wurde. Die Krankenkassenverbände lancierten 1941 einen Vorstoss zur „Konzentration der schweizerischen Sozialversicherung“, der die Errichtung einer nationalen Sozialversicherung unter Einschluss aller noch nicht realisierten Sozialversicherungszweige (Lohnausfall-, Arbeitslosigkeits-, Kranken-, Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; ausgenommen war alleine die schon bestehende Suva) vorsah. Der Bundesrat lehnte diesen Vorschlag ebenso wie das Modell des Beveridge-Berichts 1943 ab, weil er ihn für unvereinbar hielt mit der föderalistischen und von privaten Versicherern geprägten Ordnung des schweizerischen Sozialstaats.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Krankenkassen eine nachhaltige Wachstumsperiode und zugleich einen Konzentrationsprozess. Die Anzahl Versicherter nahm zwischen 1940 und 1980 um mehr als das dreifache von rund 2 auf knapp 7 Millionen zu. Zugleich halbierte sich die Zahl der Krankenkassen. Die Ausbreitung der Krankenversicherung spiegelt die Wohlstandsgewinne der Nachkriegszeit und die damit verbundene allgemeine Ausbreitung des Versicherungswesens (Abschnitt Zahlen).
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Krankenversicherung von anhaltenden Kostensteigerungen geprägt. Das Wachstum des Gesundheitssektors und die zunehmende Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen belasteten auch die Kassenfinanzen. Wo die Krankenversicherung obligatorisch war, begrenzten die Behörden oft die Höhe der Prämien. Die Kassen konnten deshalb die Prämienansätze trotz steigender Auslagen nicht angemessen erhöhen und schrieben oft strukturelle Defizite. Mit der Teilrevision des KUVG von 1964 wurden deshalb die Bundessubventionen an die Kassen deutlich ausgeweitet.
Ende der 1960er-Jahre kamen die Forderungen nach einem nationalen Krankenversicherungsobligatorium wieder auf die politische Agenda, nachdem die Sozialdemokratische Partei (SP) eine entsprechende Volksinitiative lanciert hatte. Krankenkassen und Ärzteschaft einigten sich auf einen Gegenvorschlag, der auch im Parlament unterstützt wurde und obligatorische Beitragszahlungen, jedoch kein Versicherungsobligatorium vorsah. 1974 scheiterten beide Vorlagen in der Volksabstimmung mit deutlichen Nein-Mehrheiten. Die anhaltenden Kostensteigerungen im Gesundheitswesen lösten in der Folge ein Schwarz-Peter-Spiel aus. Der Bund plafonierte aus Spargründen seine Subventionen an die Krankenkassen. Diese erhöhten in den 1980er-Jahren die Versicherungsprämien substanziell, gerieten damit aber zunehmend in öffentliche Kritik. Die Reformdebatten drehten sich deshalb vermehrt um Vorschläge zur Ökonomisierung der Krankenversicherung – eine Forderung, die nicht zuletzt von den Krankenkassen vorgebracht wurde. Nach einem gescheiteren Versuch von 1987 führte das erfolgreiche Krankenversicherungsgesetz (KVG) von 1996 nicht nur ein Bundesobligatorium ein, sondern schuf gesetzliche Grundlagen für verschiedene kostendämpfende Instrumente in der Krankenversicherung. Die Krankenkassen haben seither ihre Versicherungsangebote entsprechend ausgebaut. Zu diesen Angeboten gehörten ausgeweitete Modelle der Selbstbeteiligung der Versicherten an den Behandlungskosten (Franchise). Je höher der Versicherte die Jahresfranchise ansetzte, desto tiefer fiel seine Versicherungsprämie aus. Weiter wurden auch Versicherungsmodelle mit eingeschränkter Auswahl von Leistungserbringern eingeführt („managed care“-Modelle). Auch hier winken reduzierte Prämien, verbunden mit einer eingeschränkten Arztwahl, etwa im Rahmen von HMO-Praxen oder Hausarzt-Netzwerken. In jüngster Zeit wurden von linker Seite Forderungen nach Einführung einer staatlichen Einheitskrankenkasse vorgebracht, etwa im Rahmen einer Volksinitiative der SP und der Grünen Partei, die 2007 an der Urne abgelehnt wurde. Die Idee einer staatlichen Einheitskasse wurde damit begründet, dass sie den Administrationsaufwand reduzieren und den Wettbewerb zwischen Kassen um Versicherte mit geringen Gesundheitsrisiken beseitigen würde. Krankenkassen und bürgerliche Parteien kritisierten das Modell, weil es zu zentralistisch sei und dem Staat einen zu grossen Einfluss zugestehe.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Uhlmann, Björn, Braun, Dietmar (2011), Die schweizerische Krankenversicherungspolitik zwischen Veränderung und Stillstand, Zürich; Muheim, David (2000), Mutualisme et assurance maladie (1893-1912). Une adaptation ambigue, traverse. Zeitschrift für Geschichte, Heft 2, S. 79-93; Lengwiler, Martin, Rothenbühler, Verena (2004), Macht und Ohnmacht der Ärzteschaft. Geschichte des Zürcher Ärzteverbands im 20. Jahrhundert, Zürich; HLS / DHS / DSS:Krankenkassen.
(12/2015)