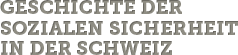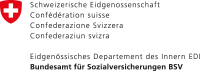Unternavigation
Ärztegesellschaften
Die Geschichte der ärztlichen Standesorganisationen geht lange von kantonalen Ärztegesellschaften aus. Die nationale Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) entwickelt sich erst im 20. Jahrhundert zu einer politisch einflussreichen Organisation.
Im 19. Jahrhundert wurde ärztliche Standespolitik weitgehend auf kantonaler Ebene betrieben. Die Helvetische Republik versuchte zwar 1798, die Gesundheitspolitik national zu vereinheitlichen, insbesondere mit einer nationalen Zulassung zur Berufsausübung. Doch nach dem Ende der Helvetik schrieb die Mediationsverfassung 1803 fest, dass das Gesundheits- und Medizinalwesen kantonale Angelegenheiten waren – eine richtungweisende Weichenstellung. Innerhalb weniger Jahre entstanden Ärztegesellschaften in den Kantonen Aargau (1805), Bern (1809), Zürich (1810) und Freiburg und Luzern (1811). Sie agierten nicht nur kantonal, sondern auch national, im Rahmen des Konkordats kantonaler Ärztegesellschaften.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Medizinalausbildung schrittweise auf nationaler Ebene vereinheitlicht. 1867 wurde das Konkordatsdiplom, 1877 das bis heute bestehende Staatsexamen eingeführt. Die Bedingungen für diese Berufspatente wurden von den ärztlichen Standesgesellschaften festgelegt. Erst 1901 wurde die heutige Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Foederatio Medicorum Helveticorum, FMH) gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war der Arztberuf bereits weitgehend professionalisiert und akademisiert. Entsprechend lagen die Gestaltung des Medizinstudiums und der Zugang zum Berufspatent in den Händen der medizinischen Standesgesellschaften. Zudem verfügte die Ärzteschaft über beste politische Netzwerke. Wenn sich Ärzte politisch engagierten, taten sie dies meist innerhalb des Freisinns, der während des 19. Jahrhunderts die nationale Politik dominierte. Diese Wahlverwandtschaft zwischen Arztberuf und Freisinnig-demokratischem Parteibuch blieb bis ins 20. Jahrhundert bestehen.
Im internationalen Vergleich besass die schweizerische Ärzteschaft eine privilegierte Stellung. Zu einer Freigabe der ärztlichen Zulassung kam es im Unterschied zu Deutschland nicht. Preussen schaffte 1869 als mächtigster Einzelstaat Deutschlands die ärztlichen Standesprivilegien ab und führte die Kurierfreiheit ein. Jeder, der sich berufen fühlte, konnte medizinische Dienstleistungen anbieten. Auch in der Schweiz übernahmen einzelne Kantone, insbesondere Appenzell Ausserrhoden, vergleichbare Regelungen. In den meisten Kantonen verhinderten die Ärztegesellschaften jedoch eine solche Öffnung. Die wirtschaftliche Stellung der Ärzte war jedoch unterschiedlich. Arztpraxen mit einer bürgerlichen oder einer wohlhabenden ländlichen Klientel standen meist auf solider finanzieller Grundlage. Praxen in ärmeren ländlichen oder industrialisierten Regionen mussten oft mit mageren Honorareinnahmen auskommen. Ein Grossteil des Ärztestandes fürchtete sich vor der sogenannten ärztlichen "Plethora", einem Überangebot an Arztpraxen mit ruinösem Wettbewerb zwischen den Ärzten.
Tarifkonflikte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Weil seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein stetig steigender Anteil der ärztlichen Klientel über Krankenkassen bezahlt wurden, hing die Entwicklung der ärztlichen Einkommen zunehmend von den Tarifverträgen zwischen Ärztegesellschaften und Krankenkassenverbänden ab. Während des Ersten Weltkriegs und in den nachfolgenden Jahren spitzte sich die ärztliche Einkommenssituation zu. Die Teuerung während der Weltkriegsjahre verringerte den Wert der Einkünfte. Die Ärztegesellschaften pochten deshalb in der Zwischenkriegszeit auf eine Anpassung der Arzttarife. Doch die Vertragspartner – die Krankenkassenverbände – stellten sich gegen die Forderungen und argumentierten, dass die Tarife eher zu hoch angesetzt waren. Mit der 1931 einsetzenden Weltwirtschaftskrise erhöhte sich der Druck, die Arzttarife zu senken. 1932 beugte sich die FMH dem Druck und empfahl den kantonalen Ärztegesellschaften einen vorübergehenden "Krisenrabatt" von bis zu zehn Prozent auf die Arzttarife. Der Vorschlag stiess in den meisten kantonalen Standesvereinigungen auf Zustimmung und wurde entsprechend umgesetzt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Tarifkonflikte, angesichts der besseren Wirtschaftslage und der grösseren finanziellen Spielräume, durch eine Erhöhung der Tarife entschärft.
In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg profitierte die Ärzteschaft vom beschleunigten Ausbau des Gesundheitswesens. Zwischen 1950 und 1980 wurde die Spitalinfrastruktur stark erweitert. Auch die Zahl der frei praktizierenden Ärzte nahm überdurchschnittlich zu, um mehr als das Doppelte zwischen 1945 und 1975, während die Gesamtbevölkerung im selben Zeitraum nur um knapp 50% anstieg.
Umstrittenes Obligatorium in der Krankenversicherung
Der Einfluss der Ärztegesellschaften auf die Gesundheitspolitik blieb auch nach 1945 bedeutend. Dies zeigt sich an den langwierigen Debatten um die Reform des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (KUVG) von 1912, das die Ausbreitung des Krankenversicherungsobligatoriums regelte. Seit den 1940er Jahren wurde von Krankenkassenverbänden und linken Parteien eine Totalrevision des KUVG gefordert, um den Geltungsbereich der sozialstaatlichen Krankenversicherung auszuweiten, bis hin zu einem nationalen Versicherungsobligatorium. Die Ärztegesellschaften waren diesen Forderungen gegenüber skeptisch, weil ihre Leistungen in der obligatorischen Krankenversicherung meist geringer entschädigt waren als in der privaten Krankenversicherung. Bereits 1949 scheiterte ein geplantes nationales Tuberkulosegesetz, das eine gesetzliche Versicherung einkommensschwacher Schichten beinhaltet hätte, in der Volksabstimmung mit 75% Nein-Stimmen. Der Widerstand ging nicht zuletzt von der FMH aus. Erst 1964, angesichts steigender Kosten für das Gesundheitswesen, kam es zu einer Teilrevision des KUVG, die sich auf unbestrittene Forderungen beschränkte. Dazu gehörten der Ausbau der gesetzlichen Mindestleistungen, die Neuordnung der Kostenbeteiligung (Franchise und Selbstbehalt) und eine Verbesserung der Krankenkassenfinanzen durch erhöhte Bundessubventionen. Anfangs der 1970er Jahre unternahm die Sozialdemokratische Partei der Schweiz mit einer Volksinitiative einen erneuten Versuch, ein nationales Krankenversicherungsobligatorium einzuführen. Die Ärzteverbände gehörten zu den Gegnern des Versicherungsobligatoriums. Zusammen mit den Krankenkassen bekämpften sie erfolgreich die Vorlage. Sie wurde 1974 zusammen mit dem parlamentarischen Gegenvorschlag in der Volksabstimmung klar abgelehnt.
In den 1980er- und 1990er-Jahren schob sich in den Debatten um eine Reform des KUVG die Kostensteigerung gegenüber der Obligatoriumsfrage zunehmend in den Vordergrund. Dies nicht zuletzt, weil die Krankenversicherung auch ohne nationales Obligatorium mittlerweile fast die gesamte Bevölkerung erreicht hatte. 1945 betrug der Anteil Krankenversicherter an der Gesamtbevölkerung noch 48%, 1970 bereits 89% und ab 1980 über 95%. Nach einem gescheiterten Versuch 1987 kam 1994 ein neues Krankenversicherungsgesetz (KVG) zustande, das 1996 eingeführt wurde. Es verfolgte zwei Hauptziele: kostendämpfende Massnahmen sowie ein nationales Versicherungsobligatorium einzuführen. Eine kostendämpfende Wirkung versprach sich der Gesetzgeber vom Ausbau der Selbstbeteiligung an den Behandlungskosten (Franchise) und von der Einführung sogenannter „managed care“-Versicherungsformen mit eingeschränkter Arztwahl (zum Beispiel HMO- oder Hausarztmodell-Versicherungen). Daneben schrieb das KVG auch eine gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur für ärztliche Einzelleistungen vor. Daraus ging der 2003/04 eingeführte Tarmed – die erste nationale Tarifstruktur – hervor. Die „managed care“-Modelle und der Tarmed waren innerhalb der Ärzteschaft allerdings heftig umstritten. Ebenfalls uneinheitlich stellte sich die Ärzteschaft zu den Forderungen nach Einführung einer nationalen Einheitskrankenkasse, als Mittel gegen die Jagd von Krankenkassen nach Kunden mit geringen Risiken und als Massnahme zur Eindämmung der Kostensteigerungen in der Krankenversicherung. Seit 2003 wird diese Forderung unter anderem von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, in Form von zwei aufeinander folgenden Volksinitiativen, vertreten. Im Vorfeld der Volksabstimmung von 2007 lehnte die FMH zwar die Einheitskasse mehrheitlich ab, verschiedene kantonale Ärztegesellschaften befürworteten jedoch das Projekt.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler, Martin, Rothenbühler, Verena (2004), Macht und Ohnmacht der Ärzteschaft. Geschichte des Zürcher Ärzteverbands im 20. Jahrhundert, Zürich; Alber, Jens, Bernardi-Schenkluhn, Brigitte (1992), Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich. Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Frankfurt am Main 1992; Braun, Rudolf (1985), Zur Professionalisierung des Ärztestandes in der Schweiz, in: Conze, Werner, Kocka, Jürgen (Hg.), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1985, S. 332-357; Vuagniaux Rachel (2002), «Le ‹médecin libre› contre le ‹bolchevisme médical›: le Bulletin professionnel des médecins suisses et les premières tentatives de révision de la LAMA (1920–1951)», Aspects de la sécurité sociale: 3, 2–9. HLS / DHS / DSS: Ärzte.
(12/2014)