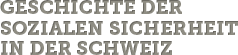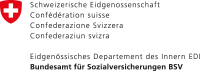Unternavigation
Verwaltung des Gesundheitssystems
Das Gesundheitssystem der Schweiz ist organisatorisch komplex. Private Akteure wie Krankenkassen, Spitäler und Ärzteverbände haben eine tragende Rolle. Auch der Föderalismus beeinflusst die Verwaltung, denn die Kantone besitzen weitreichende Kompetenzen. Seit den 1990er Jahren ist der Bund bestrebt, die Regulierung zu vereinheitlichen und kostensparende Anreize zu institutionalisieren.
Bis zur Verabschiedung des ersten Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (KUVG) 1912 hatte der Bund nur geringe Kompetenzen im Gesundheitswesen. Die Krankenversicherung wurde von privaten Hilfskassen dominiert, in denen sich die Mitglieder gegen den krankheitsbedingten Lohnausfall absicherten. Die Kassen waren selbstverwaltet und selbstreguliert. Das Spitalwesen lag in der Verantwortung Gemeinden. Mit der Gründung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 1893 verschaffte sich der Bund einen beschränkten Verantwortungsbereich im Gesundheitswesen. Zu den Bundesaufgaben gehörten neu die Umsetzung des Epidemiengesetzes, die Lebensmittelpolizei und die Medizinalprüfungen.
Föderale Organisation des Gesundheitswesens (1912-1994)
Das erste Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG) von 1912 stellte langfristig die Weichen für die Gesundheitspolitik und die Organisation des Gesundheitswesens in der Schweiz. Der Bund sah von einer Zentralisierung, etwa einem nationalen Krankenversicherungsobligatorium oder einer Zentralisierung des Krankenkassenwesens, ab. Die Versicherung blieb freiwillig, die Versicherer (Krankenkassen) privatrechtlich organisiert. Immerhin baute der Bund die Regulierung des Krankenversicherungswesens leicht aus. Neu konnten Krankenkassen Bundessubventionen beantragen. Dafür mussten sie gesetzliche Vorgaben bei den versicherten Leistungen, der Aufnahme von Mitgliedern und der Finanzierung erfüllen. Insbesondere mussten sie Frauen und Männern zu gleichen Bedingungen aufnehmen, gewisse medizinische Leistungen zwingend versichern und einen freien Kassenwechsel ermöglichen. Die Kassen verwalteten sich ansonsten selbst. Um Subventionen zu erhalten, mussten sie sich vom Bund anerkennen und beaufsichtigen lassen. Die Gründung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) 1912 war eine direkte Folge dieser neuen Bundeskompetenzen. Das BSV war nach dem BAG das zweite Bundesamt mit Verantwortlichkeiten im Gesundheitswesen. Beide gehörten zum Departement des Inneren.
Das KUVG legte auch die gesundheitspolitische Arbeitsteilung zwischen Bund und Kantonen fest. Kantone und Gemeinden konnten für ihr Gebiet die Krankenversicherung obligatorisch erklären. Über die Hälfte der Kantone richtete bis Ende der 1920er Jahre obligatorische Krankenversicherungen ein, in der Regel lediglich für geringverdienende Bevölkerungsgruppen. Lediglich die Kantone Jura und Neuenburg führten 1979 Obligatorien für die gesamte Bevölkerung ein. Einzelne Kantone wie Basel-Stadt oder ländliche Kantone wie Graubünden gründeten in der Folge öffentliche Krankenkassen. In den meisten Kantonen wurde die obligatorische Krankenversicherung von den behördlich anerkannten privaten Kassen durchgeführt.
Das Gesundheitswesen in der Schweiz war somit föderalistisch geprägt und verfügte über zahlreiche kantonale Besonderheiten. Die Kantone gründeten früh Plattformen zur Harmonisierung, zum Beispiel 1919 die Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz, die sich seit 2004 Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen- und direktoren (GDK) nennt. Innerhalb der kantonalen Verwaltungen entstanden spezialisierte Gesundheitsdepartemente, die für den Vollzug von Bundesgesetzen im Gesundheitsbereich verantwortlich waren, gesundheitspolitische Bestimmungen erliessen und die Gesundheitsdienste beaufsichtigten. Weiter waren die Kantone zuständig für die Arzneimittelkontrolle und legten die für ihr Gebiet gültigen Arzttarife fest, meist nach Absprache mit Krankenkassen und Ärzteverbänden.
Eine zentrale Rolle nahmen die Kantone im Spitalwesen ein. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Krankenhäuser Sache der Gemeinden waren, verschoben sich die Kompetenzen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend hin zu den Kantonen. Die meisten Kantone betrieben seither eine Krankenhausplanung. Kantonale Subventionen deckten einen wesentlichen Teil der Spitalkosten – neben der Infrastruktur subventionierten sie auch die Betriebskosten der öffentlichen Spitäler. In den 1980er Jahren hatten 46% der Krankenhäuser öffentliche Träger. Neben den kantonal eingerichteten öffentlichen Spitäler existierten weiterhin kommunale Krankenhäuser und Privatkliniken, die teilweise kantonal subventioniert waren. Folge der fehlenden Regulierung durch den Bund war eine grosse regionale Disparität bei der stationären Versorgung.
Nicht nur die Krankenkassen spiegeln die starke privatrechtliche Tradition des schweizerischen Gesundheitswesens. Auch Bereiche wie die zahnärztliche Versorgung und die Apotheken waren weitgehend privat organisiert. Insbesondere in Städten errichteten kommunale Behörden allerdings Volks- oder Schulzahnkliniken, die weitgehend von der öffentlichen Hand finanziert waren. Die Ärzteschaft war mehrheitlich freiberuflich tätig. Der Anteil der in Spitälern angestellten Ärztinnen und Ärzte wuchs im Verlauf des 20. Jahrhunderts von 10 auf fast 50%. Der nationale Ärztevereinigung FMH blieb deshalb lange Zeit von den Interessen der frei praktizierenden Ärzteschaft dominiert.
Grundsätzlich waren die Aufgabenteilungen und die durch das KUVG festgelegten Kompetenzbereiche sehr stabil. Lediglich 1964 kam es wegen der schwierigen finanziellen Lage der Krankenkassen zu einer Teilrevision des KUVG, mit der der Bund das Ausmass seiner Subventionen ausweitete. Die Reform koppelte die Bundessubventionen an die Ausgabenentwicklung der Kassen und sollten 30% der Ausgaben decken. Der grösste Teil der Gesundheitskosten wurde somit nach wie vor über die Krankenkassenprämien finanziert.
Kompetenzausweitung des Bundes und Aufgabenkonzentration (seit 1994)
1994 nahm die Stimmbevölkerung das neue Krankenversicherungsgesetz (KVG) in einer Abstimmung an. 1996 trat das Gesetz in Kraft. Das KVG führte die obligatorische Grundversicherung auf nationaler Ebene ein. Die Grundversicherung legte einen durch die Kassen zu erfüllenden Leistungskatalog fest. Auch die Spitalpflege war nun einheitlich im Obligatorium versichert. Die Versicherten behielten grundsätzlich eine freie Arztwahl. Der Status der Krankenkassen wurde durch die Reform nicht grundlegend verändert. Der grösste Teil der Kassen organisierte sich weiterhin privatrechtlich in einem staatlich regulierten Geschäftsfeld. Das KVG stärkte die Bundesaufsicht über die Tätigkeiten und die Organisation der Kassen.
Das KVG verpflichtete neu die Kassen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz in die Grundversicherung aufzunehmen und unabhängig von Geschlecht, Alter oder Gesundheitsrisiko dieselben Prämien zu erheben. Das Gesetz liess gewisse Schwankungen der Prämien zu: kantonale und teilweise innerkantonale Unterschiede je nach den jeweiligen Pro-Kopf-Kosten und kassenspezifische je nach Versicherungsform. Die Finanzierung erfolgte im Umlageverfahren: Die Versicherer bezahlten die laufenden Ausgaben aus den zeitgleich eingehenden Einnahmen, hauptsächlich den Prämien. Zusätzlich waren die Kassen gehalten, Mindestreserven anzulegen. Zwischen den Kassen wurde ein Risikoausgleichsfonds eingeführt, der die ungleiche Risikoverteilung, beispielsweise das je nach Kasse unterschiedliche Durchschnittsalter der Versicherten, ausgleichen sollte, um unter den Kassen eine Jagd nach «guten Risiken» zu verhindern. Kassen, die eine hohe Anzahl an Personen mit einem niedrigem Erkrankungsrisiko versicherten, mussten zugunsten anderer Kassen Ausgleichsbeiträge entrichten.
Trotz ausgeweiteter Grundversicherung blieben die privaten Zusatzversicherungen ein wichtiger Geschäftszweig der Krankenkassen. Die Zusatzversicherungen deckten nicht gesetzlich vorgeschriebene Leistungen wie Zahnbehandlungen oder besondere Spitalbehandlungen ab. Hier hatten die Kassen einen grösseren Handlungsspielraum und konnten Versicherte ausschliessen. Die Zusatzversicherungen fielen unter das Privatversicherungsrecht und wurden deshalb von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. Der Ausbau der obligatorischen Grundversicherung führte dazu, dass der Bereich der Zusatzversicherungen seit 1996 an Bedeutung verloren hat. Während sich die Nettoleistungen der Grundversicherungen seit 1996 fast verdoppelt haben, haben sich diese der Zusatzversicherungen im gleichen Zeitraum gar leicht verringert (1996 4,3 Mrd. Franken, 2012 4,0 Mrd. Franken). Auch die Prämieneinnahmen der Zusatzversicherungen stiegen weitaus geringer an als diejenigen der obligatorischen Grundversicherung.
Das KVG verpflichtete die Versicherer, auch präventive Ansätze stärker zu verfolgen. Kantone und Krankenkassen gründeten 1996 die Stiftung «Gesundheitsförderung Schweiz», deren Tätigkeiten durch einen Beitrag der Versicherten finanziert werden. Der Zweck der Stiftung liegt darin, gesundheitsfördernde und krankheitspräventive Massnahmen zu initiieren, zu koordinieren und zu evaluieren.
Das KVG führte in einigen Bereichen zu Vereinheitlichungen im Gesundheitswesen. So schrieb es schweizweit einheitliche Arzttarife vor, worauf 2004 die erste nationale Tarifsstruktur Tarmed eingeführt wurde. Die Ärzteschaft, Krankenversicherer, Spitäler und die Sozialversicherungen trugen diese gemeinsam. Seit 2013 konnte der Bundesrat eigenständig den Tarmed anpassen, wenn sich die Tarifpartner nicht zu einigen vermochten. Der Bundesrat machte 2014 und 2018 von dieser Kompetenz Gebrauch.
Auf Bundesebene übernahm ab 2004 das BAG die Regulierungs- und Aufsichtsfunktionen des BSV im Krankenversicherungsbereich. Von nun an musste das BAG das dezentral organisierte Versicherungswesen beaufsichtigen, also kontrollieren, dass die Versicherer das KVG einheitlich anwenden und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Die Aufsichtspflicht des BAG ist durch das 2014 eingeführte Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (KVAG) geregelt, das Bestimmungen über die Reserven und das Vermögen von Krankenversicherern und Kriterien für die Prämiengenehmigung erhält.
Die Schweiz hat das historisch gewachsene System einer einkommens- und vermögensunabhängigen «Kopfprämie» nie grundsätzlich in Frage gestellt, obwohl es Geringverdienende finanziell stärker belastet als höhere Einkommensgruppen. Um der ungleichen finanziellen Belastung entgegenzuwirken, führte das KVG 1996 das Instrument individueller Prämienverbilligungen ein. Der Ausgleich sah vor, dass Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine individuelle Verbilligung ihrer Prämien erhielten. Die Durchführung dieser Massnahme oblag den Kantonen, was zu ungleichen Anspruchsregelungen führte. Finanziert wurden die Zahlungen durch Bund und Kantone. Das Instrument entwickelte sich bald zu einer grossen sozialstaatlichen Umverteilung. 2017 waren über ein Viertel der Versicherten verbilligungsberechtigt. Die ausgeschütteten Mittel beliefen sich auf 4,5 Milliarden CHF – deutlich mehr als etwa die gesamten Landwirtschaftssubventionen des Bundes.
Weiterhin konnten die Kantone unter Beachtung der Bundesgesetze eigene Gesundheitsgesetze einführen. Die Planung, Führung und Teil-Finanzierung der öffentlichen Spitäler sowie die medizinische Nothilfe lagen nach wie vor in ihrem Verantwortungsbereich. Das KVG regulierte 1996 die Spitalplanung: Spitallisten legten nun fest, in welchen Spitälern die nun obligatorisch versicherten Patientinnen und Patienten behandelt werden können. Mit der 2012 eingeführten Revision des KVG konnten auch private Spitäler auf den Spitallisten aufgenommen werden. Die Listenspitäler wurden von nun an mittels «Fallpauschalen» leistungsbezogen zu 45 Prozent von den Versicherungen und zu 55 Prozent von der öffentlichen Hand finanziert. Damit regulierte der Bund vermehrt die kantonalen Kompetenzen im Spitalbereich mit dem Ziel, kostensparende Anreize zu institutionalisieren.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Alber Jens, Bernardi-Schenkluhn Brigitte: Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich. Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Frankfurt am Main 1992; Uhlmann Björn, Braun Dietmar: Die schweizerische Krankenversicherungspolitik zwischen Veränderung und Stillstand, Chur/Glarus 2001; Oggier, Willy (Hrsg.): Gesundheitswesen Schweiz 2015-2017, Bern 2015; Website des Bundesamts für Gesundheit: www.bag.admin.ch; Ärztestatistik des FMH: www.fmh.ch; HLS / DHS / DSS: Gesundheitswesen, Spital, Krankenversicherung, Krankenkassen.
(05/2020)