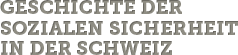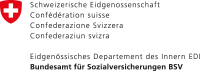Unternavigation
Menschen mit Behinderung
Behindert-Sein ist eine historische Grunderfahrung der menschlichen Existenz. Bis ins 20. Jahrhundert hinein sind die meisten Frauen und Männer, die durch ihre Behinderung erwerbslos wurden, von der Fürsorge abhängig. Mit der Einführung der Sozialversicherungen, insbesondere der Invalidenversicherung (IV) im Jahre 1960, verbessert sich ihre Lage zusehends. Die Sozialversicherungen reduzieren das Behindert-Sein allerdings primär auf den Aspekt der Erwerbsunfähigkeit. Soziale und kulturelle Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung geraten dadurch aus dem Blick. Die aktuelle Gleichstellungs- und Integrationspolitik will solchen Entwicklungen entgegenwirken.
Ob jemand behindert ist, hängt von vielen Faktoren ab. Von körperlichen und geistigen Einschränkungen, von Barrieren im Alltag und im Berufsleben, von gesellschaftlichen Vorurteilen, aber auch von den Lebenschancen und Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Zudem haben Menschen mit Behinderungen ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Schliesslich besitzt der Begriff der Behinderung je nach historischer Epoche unterschiedliche Bedeutungen.
Behindert-Sein vor der modernen Sozialversicherung
In früheren Jahrhunderten gehörten Behinderungen zum Alltag vieler Männer und Frauen. Fehlende medizinische Versorgung oder mangelhafte Ernährung hatten zur Folge, dass schwere Geburten, Krankheiten oder Unfälle oft zu bleibenden Schädigungen führten. Kindheit und Alter waren besonders risikoreiche Lebensabschnitte. Kinder, die nicht gesund waren, hatten geringe Chancen, die ersten Lebensjahre zu überleben. Im Vergleich zu heute setzte auch der natürliche Alterungsprozess früher ein. So war bis ins 19. Jahrhundert hinein ein Grossteil der über 30-Jährigen bereits von Seh- und Hörschwächen betroffen. Frauen und Männer mit Behinderungen weckten aber auch Aufsehen und Ablehnung. Der Umgang mit missgebildeten oder kleinwüchsigen Menschen schwankte bis ins 19. Jahrhundert hinein zwischen Erschrecken und Faszination, wie etwa die Zurschaustellung solcher „Zwerge“ und „Freaks“ auf Jahrmärkten zeigt. Solche Geburtsgebrechen galten als „Laune der Natur“, die – je nach Standpunkt – von der Vielfalt des Lebens oder von Gottes Zorn kündeten.
Vor allem körperliche Gebrechen waren oft mit einer starken Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit verbunden. Wer deswegen kein Auskommen fand und nicht von der Familie unterstützt wurde, fiel in Armut und konnte in Klöstern oder Spitälern versorgt werden. Vielerorts war es üblich, Menschen mit Behinderungen eine Ausnahmeerlaubnis zum Betteln zu geben. Kranke und Gebrechliche hatten als „würdige Arme“ Anrecht auf Hilfe – dies im Gegensatz zu arbeitsfähigen Armen, denen im 19. Jahrhundert der Zugang zu öffentlichen Unterstützungsleistungen meist konsequent verwehrt wurde. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb jedoch die finanzielle Unterstützung von Menschen mit Behinderung bescheiden und abhängig vom individuellen Bedarf.
Der Glaube an die Bildungsfähigkeit des Individuums, der mit der Aufklärung zum Durchbruch gelangte, führte langfristig zu einer veränderten Wahrnehmung von Behinderung und zur Entstehung der modernen Heilpädagogik. Der pädagogische Optimismus betraf zunächst vor allem Menschen mit Sinnes- und geistigen Behinderungen. Nach 1800 entstanden in der Schweiz zahlreiche Anstalten für Blinde, Taubstumme und Menschen mit einer geistigen Behinderung. Parallel dazu etablierte sich die moderne Psychiatrie, die psychisch Kranke heilen wollte. Die neuen Einrichtungen, die grösstenteils heute noch bestehen, beruhten auf einer Kombination von räumlicher Separierung und besonderer Fördermassnahmen. So erhielten blinde Mädchen und Knaben Unterricht in der Braille-Schrift, gehörlosen Kindern wurde die Lautsprache – oder ausnahmsweise die Gebärdensprache – beigebracht. Nach der Verankerung der allgemeinen Schulpflicht in der Bundesverfassung von 1874 richteten viele Kantone und Gemeinden Hilfsklassen und Sonderschulen für Kinder mit einer (Lern-)behinderung ein, die bis dahin oft auf den Schulbesuch verzichten mussten. Im 20. Jahrhundert erweiterte sich dann der Zugriff der Heil- und Sonderpädagogik auf verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, die als „schwererziehbar“ galten.
Wissenschaftliche Innovationen, besonders in der Hygiene und der Chirurgie, verstärkten im 19. Jahrhundert die medizinische Sicht auf (körperliche) Normabweichungen. So spezialisierte sich die Orthopädie auf die Normalisierung missgebildeter Gliedmasse mittels gymnastischer Übungen und chirurgischer Eingriffe. Operationstechniken zur Behandlung des Klumpfusses oder des Kropfs wurden entwickelt. Dagegen blieb der Aufschwung des Spitalwesens für Chronischkranke und Menschen mit Behinderung ambivalent. Stärker als die alten Spitäler unterschieden die neuen Kliniken zwischen heilbaren und unheilbaren Gebrechen. Patientinnen und Patienten mit Leiden, die keine Aussicht auf Heilung hatten, blieben somit von der verbesserten Versorgung ausgeschlossen. Waren sie armengenössig und hatten keine Familie, mussten sie ihr Leben häufig in einer Armenanstalt fristen. Nach 1900 entstanden vermehrt spezialisierte Heil- und Fürsorgeeinrichtungen, zum Beispiel für Frauen und Männer, die an Tuberkulose litten.
Der Umgang mit Menschen mit Behinderung löste im 20. Jahrhundert auch neue Ängste aus. Auftrieb erhielten sie zum Beispiel durch Entdeckungen und Annahmen auf dem Gebiet der Vererbungsforschung. Menschen mit Behinderung wurden dabei als „minderwertig“ tituliert und Missbildungen und Gebrechen als Zeichen des gesellschaftlichen Niedergangs interpretiert. Nach 1900 gewannen innerhalb der Psychiatrie, aber auch der Heilpädagogik eugenische Bestrebungen an Boden, die die „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ propagierten. Massnahmen wie Heiratsverbote oder Sterilisationen, die eugenisch, aber auch sozialpolitisch motiviert waren, betrafen vor allem Menschen mit (vermeintlichen) geistigen Beeinträchtigungen und psychisch Kranke, in geringerem Ausmass auch Gehörlose oder Blinde. Die Kritik an der Zwangssterilisation von 400‘000 und der Ermordung von weit über 100‘000 Männer mit Behinderung und Frauen mit Behinderung im nationalsozialistischen Deutschland führten nach 1945 dazu, dass sich in der Schweiz wachsende Kreise von eugenischen Praktiken distanzierten.
Mit dem Nachkriegsboom und der Liberalisierung zahlreicher Gesellschaftsbereiche veränderte sich auch die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen. Das Ziel der individuellen Förderung trat nun mehr und mehr in den Vordergrund und Kostenargumente spielten eine geringere Rolle. Seit den 1980er-Jahren wird in der Öffentlichkeit die Frage der Schutzbedürftigkeit und der Akzeptanz behinderten Lebens erneut diskutiert, wenn auch unter grundlegend veränderten Bedingungen. Der medizinische Fortschritt zeigt dabei ein doppeltes Gesicht: zum einen nimmt die Zahl der Therapien zu, mit denen unfall- und geburtsbedingte Gebrechen erfolgreich behandelt und kuriert werden können. Zum andern ermöglicht die rasante Entwicklung der Pränataldiagnostik, immer mehr Behinderungen vor der Geburt zu erkennen. Betroffene Frauen und Paare werden dadurch vor den schwierigen Entscheid für oder gegen eine Abtreibung gestellt. Am andern Lebensende hat die Steigerung der Lebenserwartung eine Zunahme altersdementer Menschen zur Folge, die bei ihren alltäglichen Verrichtungen stark eingeschränkt sind und intensive Pflege benötigen.
Die Perspektive der Sozialversicherung: Behinderung als Invalidität
Die modernen Sozialversicherungen nahmen sich nicht nur dem Risiko Behinderung an. Sie gaben auch dem Behindert-Sein eine spezifische Bedeutung. Sozialversicherungen, die in der Tradition der Bismarck’schen Klassenversicherung standen, betrachteten Männer und Frauen mit Behinderungen in erster Linie unter dem Aspekt der Erwerbsunfähigkeit. Invalidität – so der massgebende versicherungstechnische Terminus – bedeutete demnach eine Einschränkung der Erwerbsfähigkeit. Diese konnte je nach Fall zeitlich befristet oder dauerhaft, ganz oder teilweise sein. Der Invaliditätsgrad, eine wichtige versicherungstechnische Grösse, bemass sich an der Einkommensdifferenz zwischen der Zeit vor und nach dem Eintreten der Erwerbsunfähigkeit. Konsequenterweise beschränkte sich der Versicherungsschutz zunächst auf Erwerbsausfälle- und somit auf Personen, die erwerbstätig waren.
Als erste Sozialversicherungszweige richteten die Militär- und die Unfallversicherung, die 1902 respektive 1918 eingeführt wurden, Renten für invalide Versicherte aus. Ebenfalls vorgesehen waren medizinische Rehabilitationsmassnahmen zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit. Mit der Zeit begannen auch Pensionskassen (zunächst jene öffentlicher Einrichtungen, später auch unternehmerische Kassen), Invalidenrenten auszuzahlen. Der Versicherungsschutz blieb allerdings punktuell und lückenhaft. Versichert und leistungsberechtigt war nur, wer erwerbstätig und einer Versicherung angeschlossen war – oder wer im Fall der Militärversicherung Militärdienst leistete. Die Unfallversicherung deckte zudem nur Arbeitsunfälle und anerkannte Berufskrankheiten ab. Auch die Zahl der Versicherten blieb begrenzt. Bis in die 1980er-Jahre war nur gerade jeder zweite Beschäftigte obligatorisch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) versichert. Die Zahl der Beschäftigten, die bei privaten Gesellschaften versichert war, nahm allerdings über die Jahrzehnte hinweg laufend zu. Die Fokussierung auf den Erwerbsausfall hatte zur Folge, dass Frauen, Kinder und ältere Personen, die nicht erwerbstätig waren, keinen Versicherungsschutz genossen. Konkret hiess dies, dass ein grosser Teil der Frauen und Männer mit Behinderungen weiterhin von der Fürsorge abhängig waren. Dies betraf insbesondere Personen mit Geburtsgebrechen, die nie eine Erwerbstätigkeit ausüben konnten.
Solche Lücken zu schliessen, war ein Hauptziel der Invalidenversicherung (IV), die 1960 nach einer langen Vorgeschichte und auch auf Druck der Behindertenorganisationen (u. a. des Schweizerischen Invalidenverbands) zustande kam. Auch die IV knüpfte an den versicherungsrechtlichen Begriff der Invalidität an. Massgebend für die Rentenberechnung sind die Dauer der Erwerbstätigkeit und die Höhe der geleisteten Beiträge. Wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) als Volksversicherung konzipiert, umfasste die IV von Beginn an auch Personen mit Geburtsgebrechen, die nie Beiträge geleistet hatten. Auch sie haben Anspruch auf eine minimale Rente – und später wie die AHV-Rentnerinnen und Rentner auf Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung. Zudem unterscheidet die IV nicht nach der Art der Beeinträchtigung, so dass – 1960 europaweit ein Novum – auch Menschen mit einer geistigen Behinderung versichert sind. Die IV kannte zunächst ganze und halbe Renten, die nach dem Grad der Invalidität abgestuft waren. Ab einem Invaliditätsgrad von 66 2/3 wurde eine ganze, ab 50 Prozent eine halbe Rente ausgerichtet. 1986 wurden zusätzlich Viertelrenten für Personen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 40 und 50 Prozent eingeführt. Neben Renten sieht die IV Massnahmen zur medizinischen Rehabilitation und zur beruflichen Eingliederung vor. Weiter finanziert sie Hilfsmittel – etwa Gehhilfen oder Hörgeräte – und richtet Subventionen an Sonderschulen oder Institutionen aus. Letztere werden seit 2011 im Rahmen des Neuen Finanzausgleichs vollumfänglich von den Kantonen finanziert.
Von Anfang an war die IV dem Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ verpflichtet. Rentenberechtigt ist nur, wer trotz Eingliederungsmassahmen keine zumutbare Arbeit ausüben kann. Da bis heute ein Grossteil der Männer und Frauen mit einer (leichten) Beeinträchtigung im Arbeitsprozess integriert ist, blieb die Zahl der IV-Renten immer relativ klein. 2011 lebten in der Schweiz schätzungsweise 600.000 Menschen mit einer Behinderung im erwerbstätigen Alter, im gleichen Jahr richtete die IV 238.000 Renten aus. Für Menschen mit Behinderung, die Leistungen der IV beantragen, bedeutet der Eingliederungsgrundsatz, dass sie sich zunächst einer medizinischen oder beruflichen Massnahme unterziehen müssen. Dazu können eine Therapie, eine Umschulung oder die Vermittlung einer Arbeitsstelle gehören. Von Beginn an verpflichtete die IV die Versicherten, an solchen Massnahmen mitzuwirken. Ansonsten konnten Leistungen gestrichen oder nicht gewährt werden.
Bedingt durch das gebremste Wirtschaftswachstum, die Rationalisierung der Arbeitsabläufe und die Erweiterung der medizinischen Krankheitsdefinitionen stieg die Zahl der Neurenten Ende der 1990er-Jahre stark an. Gleichzeitig begannen politische Parteien, die Missbrauchsproblematik auf die politische Agenda zu setzen. Seit den 1990er Jahren stieg auch der Druck, leistungsbeeinträchtige, vor allem aber psychisch kranke Menschen stärker als bisher in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die 5. IV-Revision (2008) führte deshalb Massnahmen zur Früherfassung und Frühintervention ein, die versicherungstechnisch die Grenzen zwischen Invaliden und Nicht-Invaliden auflöste. Ebenfalls verstärkt wurde die Zusammenarbeit zwischen IV, Arbeitslosenversicherung und Fürsorge. Für die betroffenen Personen erwiesen sich die Neuerungen indes als zweischneidig, zumal weitere Sparmassnahmen – wie die Revision von Altrenten – politisch nicht vom Tisch sind. Auf der einen Seite wurden die Eingliederungsbemühungen intensiviert, auf der anderen Seite nahm der Druck auf Menschen mit gesundheitlichen Leistungsbeeinträchtigungen zu, sich den Zwängen einer Erwerbsgesellschaft zu unterwerfen, die ihren Bedürfnissen oft nur schlecht Rechnung trägt.
Neue Ansätze: Gleichstellung und Integration
Behindert zu sein bedeutet oft auch diskriminiert zu werden. Dies trifft nicht zuletzt auf die Sozialpolitik zu. Auch die IV selber blieb lange eine Angelegenheit von Verwaltungsbeamten, Juristen, Ärzten und Versicherungsmathematikern, bei der die Betroffenen wenig zu sagen hatten. Im Anschluss an die 68er-Bewegung stellte eine jüngere Generation von engagierten Menschen mit Behinderung die Definitionsmacht der Behörden und Experten jedoch zunehmend in Frage. So griff zum Beispiel die Zeitschrift Puls Themen wie behindertengerechtes Bauen und Wohnen, Sexualität oder das Verhältnis von Menschen mit und ohne Behinderungen auf – Anliegen, die in der politischen Diskussion bislang kaum eine Rolle gespielt hatten. Kritisch beleuchtet wurden auch die Aktivitäten der offiziellen Schweiz zum UNO-Jahr der Menschen mit Behinderung 1981.
Als Motor der neuen Behindertenbewegung, in der sich die einzelnen Behindertengruppen unterschiedlich stark engagierten, erwies sich die Forderung nach Gleichstellung. Die Aktivistinnen und Aktivisten stellten Behinderung als eine Folge gesellschaftlicher Diskriminierung dar. In dieser Lesart hatte sich die Gesellschaft den besonderen Bedürfnissen beeinträchtigter Menschen anzupassen – und nicht umgekehrt. Als ausgesprochen neuralgisch galten die Bereiche Mobilität, Ausbildung oder eigenständiges Wohnen. Kurz nach Ablehnung der 4. IV-Revision, die erstmals seit Gründung des Sozialwerks Leistungseinbussen vorgesehen hatte, lancierten die Behindertenverbände 1998 eine Volksinitiative, die in der Bundesverfassung ein umfassendes Diskriminierungserbot verankern wollte. Nachdem das Parlament einem indirekten Gegenvorschlag zugestimmt hatte, lehnten Volk und Stände die Initiative fünf Jahre später jedoch ab. Das neue Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) trat deshalb am 1. Januar 2004 in Kraft. Zentrale Punkte betreffen den Zugang zu öffentlichen Bauten, zum öffentlichen Verkehr und zu Verwaltungsdienstleistungen. Im Vergleich zum Invaliditätsbegriff der Sozialversicherungen geht das BehiG von einem deutlich breiteren Verständnis von Behinderung aus. So sieht es das Mass einer Behinderung in Abhängigkeit von der Fähigkeit, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen oder sich aus- und fortzubilden.
Das Gleichstellungspostulat stellt die Förderung der Integration und Autonomie ins Zentrum. So verpflichtet das BehiG die Kantone, die integrative Schule stärker auf Kosten der Sonderschule zu fördern. Kinder mit Behinderungen sollen nach Möglichkeit in einer Regelklasse unterrichtet werden. Die Umsetzung dieser Bestimmung gestaltete sich allerdings aufwändiger als angedacht. Die Frage der Autonomie kam auch mit dem 2023 veröffentlichte Entwurf zur Teilrevision des BehiG erneut auf. So kritisierten Interessenverbände etwa, dass die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr im Entwurf zu kurz komme.
Auch in der Invalidenversicherung wurde die Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderungen gestärkt. Mit der 6. IV-Revision (Revision 6a) wurde – nach mehreren Pilotversuchen – der Assistenzbeitrag eingeführt. Zu Hause lebende Personen, die Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben, können für persönliche Hilfeleistungen künftig auf Kosten der IV Drittpersonen anstellen. Die Betroffenen können so ihre Betreuung selbstständig organisieren und gemäss ihren eigenen Bedürfnissen gestalten. Je nach Fall wird dadurch die Unterbringung in einem Heim überflüssig. Die Stärkung der Autonomie – und Eigenverantwortung – kommt deutlich in der Umkehr der Finanzflüsse zum Ausdruck. Diese laufen nun nicht mehr von der Versicherung zu den Institutionen, sondern direkt zu den Versicherten
Im Jahr 2022 trat die «Weiterentwicklung der Invalidenversicherung» (WEIV) in Kraft. Diese Gesetzesrevision fördert die Eingliederung ins Berufsleben weiter und soll gleichzeitig der Invalidisierung vorbeugen. Die weitreichendste Reform bezieht sich auf das System der Rentenbemessung: Neu gilt ein sogenanntes «lineares Rentensystem» oder «stufenloses Rentensystem». Der Rentenanspruch wird jetzt auf das Prozent genau abhängig vom Invaliditätsgrad bemessen. Der Invaliditätsgrad ist stark von der medizinischen Begutachtung abhängig. Die WEIV führt diesbezüglich Massnahmen ein, die eine höhere Transparenz und eine bessere Qualität der Gutachten sichern sollen. Die Invalidenrente wird im neuen System als Prozentsatz einer ganzen Rente festgelegt. Ab einem Invaliditätsgrad von 70% besteht Anspruch auf eine volle Rente. Darunterliegende Invaliditätsgrade führen zu einem prozentualen Rentenanspruch. Beibehalten wurde die Regelung, dass unter einem Invaliditätsgrad von 40% kein Anspruch auf eine Invalidenrente besteht.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Germann Urs (2010), Integration durch Arbeit. Behindertenpolitik und die Entwicklung des schweizerischen Sozialstaats 1900–1960, in: E. Bösl et al. (ed.), Disability History. Konstruktionen von Behinderung in der Geschichte, Bielefeld, 151–168; Kaba Mariama (2007), Des reproches d’inutilité au spectre de l’abus. Etude diachronique des conceptions du handicap du XIXe siècle à nos jours, in: Carnets de bord, 13, 68–77; Wolfisberg Carlo (2002), Heilpädagogik und Eugenik. Zur Geschichte der Heilpädagogik in der deutschsprachigen Schweiz, Zürich; Graf Otto Maria (ed.) (2011), PULS – DruckSACHE aus der Behindertenbewegung. Materialien für die Wiederaneignung einer Geschichte, Zürich. Canonica Alan (2012), Missbrauch und Reform. Dimensionen und Funktionen der Missbrauchsdebatten in der schweizerischen Invalidenversicherung aus historischer Perspektive, in: Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 13, 2012, S. 24-37. Canonica Alan (2020), Beeinträchtigte Arbeitskraft. Konventionen der beruflichen Eingliederung zwischen Invalidenversicherung und Arbeitgeber (1945-–2008), Zürich. Nadai Eva, Canonica Alan, Gonon Anna, Rotzetter Fabienne, Lengwiler Martin (2019), Werten und Verwerten. Konventionen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Wirtschaft und Wohlfahrtstaat, Wiesbaden. Gonon Anna, Rotzetter Fabienne (2017), Zückerchen für Arbeitgebende. Sozialstaatliche Anreize zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen in der Schweiz, in: Soziale Passagen 9, S. 153-168.
HLS / DHS / DSS: Behinderte.
(07/2024)