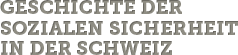Die Industrialisierung prägte die Schweiz zwischen der Bundesstaatsgründung 1848 und der Jahrhundertwende stark. Die Bevölkerung wuchs von 2.4 auf 3.3 Millionen. Immer mehr Frauen und Männer zogen vom Land in die Stadt und arbeiteten als Lohnabhängige in Industrie und Gewerbe. Zürich, Basel und Genf entwickelten sich zu urbanen Wirtschaftszentren. Man brach die Stadtmauern ab und zog neue Aussenquartiere hoch. Die liberale Wirtschaftsordnung und technische Innovationen begünstigten den Bau von Eisenbahnlinien und Fabriken. Zunehmend löste die Maschinen- die Textilindustrie als wirtschaftliches Zugpferd ab. Der Aussenhandel florierte und es etablierte sich ein moderner Dienstleistungssektor (Banken, Versicherungen).
Diese Entwicklungen verliefen nicht reibungslos. Die Wachstumsschübe wurden durch Krisen gebremst. Der Wohlstand und die allgemeinen Lebenschancen blieben höchst ungleich verteilt. Breite Bevölkerungsschichten blieben von Armut bedroht. Angesichts der wachsenden Mobilität und der Entstehung neuer Erwerbsformen wie der Fabrikarbeit konnten die Familien und die Dorfgemeinschaften die Folgen von Not und Armut immer weniger auffangen. Gleichzeitig hielt der frühliberale Staat die öffentliche Armenfürsorge klein und überliess viele Versorgungsaufgaben privaten Armenvereinen, genossen- und gewerkschaftlichen Hilfskassen und den Kirchen.
Die Öffentlichkeit verhandelte das Problem der Armut zunächst unter dem Stichwort des "Pauperismus". Um 1850 kam der Begriff der "sozialen Frage" auf, der stärker auf die Lage der wachsenden Arbeiterschaft zugeschnitten war und der Entstehung eines reformistischen, das heisst nicht revolutionären Flügels der Arbeiterklasse Rechnung trug. Eine wichtige Rolle in dieser Diskussion spielten zunächst die gemeinnützigen Gesellschaften, die das Ethos der Selbsthilfe propagierten und Armut als eine Folge mangelnder Moral betrachteten. Mit der Wirtschaftskrise der 1870er-Jahre und der Erosion des liberalen Gesellschaftsmodells erhielt die Idee einer staatlichen "Socialreform" auch in der bürgerlichen Elite Auftrieb. Die Vorstellung, dass der Staat als "Repräsentant der Gesamtinteressen" zugunsten sozial benachteiligter Gruppen und gestützt auf Experten in das Wirtschaftsleben eingreifen müsse, setzte sich weitgehend durch. Wie dies geschehen sollte und in welchem Ausmass, blieb aber weiterhin Gegenstand von Auseinandersetzungen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Degen Bernard (2006), Entstehung und Entwicklung des schweizerischen Sozialstaates, Studien und Quellen, 31, 17–48; Studer Brigitte (1998a), Soziale Sicherheit für alle? Das Projekt Sozialstaat 1848–1998, in B. Studer (ed.), Etappen des Bundesstaates. Staats- und Nationsbildung in der Schweiz, 159–186, Zürich; HLS / DHS / DSS: Soziale Frage.
(12/2016)
Die Unterstützung von Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnten, gehörte in der Schweiz traditionell zu den Aufgaben der Gemeinden. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt das Prinzip der Unterstützung im Heimatort. Auswärtige Bedürftige konnten deshalb mittels "Armenfuhren" in ihre Heimatgemeinden zurückgeschickt werden. Zugleich behinderte die Unterstütztung im Heimatort die Stellensuche an andern Orten. Die Verrechtlichung des Armenwesens vergrösserte den Einfluss der Kantone auf die Armenhilfe, während die Kompetenzen des Bundes weiterhin marginal blieben. Mit der Einführung des Alkoholzehntels 1887 bekamen die Kantone erstmals Bundesgelder, die für die Bekämpfung des Alkoholismus oder der mangelhaften Erziehung eingesetzt werden konnten, die in den Augen der Zeit wichtige Armutsursachen darstellten.
Besonders von Armut bedroht waren Betagte, Frauen und Kinder. Unter den bürgerlichen Eliten war eine moralisierende Betrachtung von Armut vorherrschend: Nur "würdige" Arme, die infolge von Alter, Jugend, Familienverpflichtungen, Krankheit oder Behinderung nicht erwerbsfähig sein konnten, sollten unterstützt werden. Arbeitsfähigen Armen unterstellte man dagegen mangelnden Arbeitswillen, "Leichtsinn" oder "Verschwendungssucht". Strukturelle Ursachen von Armut wurden dagegen ausgeblendet. Nach 1850 verringerte sich die Massenarmut zwar, doch wirtschaftliche Einbrüche brachten Menschen immer wieder in Not.
Um die Armut zu bekämpfen, bauten die Kantone und Gemeinden die Volksschule aus, passten die Unterstützungspraxis den neuen Notlagen an (Übertragung von Aufgaben an private Vereinigungen, später Wohn- statt Heimatortsprinzip), förderten die Auswanderung, errichteten Armen- und Erziehungsanstalten für mittellose Betagte und Kinder oder ergriffen repressive Massnahmen (Zwangsarbeitsanstalten, Heiratsverbote, Ausschluss vom Wahlrecht), die gesellschaftliche Randgruppen stigmatisierten.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Head Anne-Lise, Schnegg Brigitte (ed.) (1989), Armut in der Schweiz (17.–20. Jh.), Zürich; Lippuner Sabine (2005), Bessern und Verwahren: Die Praxis der administrativen Versorgung von „Liederlichen“ und „Arbeitsscheuen“ in der thurgauischen Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain (19. und frühes 20. Jahrhundert), Frauenfeld; HLS / DHS / DSS: Fürsorge.
(12/2014)
Die Hilfskassen waren ein Bindeglied zwischen traditionellen - beispielsweise zünftischen - Formen der Vorsorge und dem modernen Typus der Sozialversicherungen. Die ersten Kassen, die als Vereine organisiert waren, entstanden bereits Ende des 18. Jahrhunderts. Bis in die 1870er-Jahre verbreiteten sie sich vor allem in den industrialisierten Regionen und den Städten. 1888 zählte die Schweiz 1.085 Hilfskassen mit 209.920 Mitgliedern. In Industrieregionen waren bis zu 25 Prozent der Erwerbstätigen Mitglied einer Kasse. Einige Kassen standen allen Interessierten offen, die meisten wurden aber von Berufsverbänden, Arbeitgebern oder Gewerkschaften getragen.
Die Hilfskassen waren - anders als die Armenfürsorge - auf Erwerbstätige, vor allem auf die wachsende Industriearbeiterschaft ausgerichtet. Sie beruhten auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und des Risikoausgleichs: Die Mitglieder mussten regelmässig eine Prämie bezahlen und erhielten dafür ein bescheidenes Taggeld, das sie gegen Lohnausfall infolge von Krankheit und Invalidität absicherte. Besondere Sterbekassen übernahmen die Kosten für das Begräbnis der Versicherten. Ab den 1880er-Jahren boten einige Kassen auch Alters-, Witwen- oder Waisenrenten an und traten damit in Konkurrenz zu kommerziellen Versicherern wie der 1857 gegründeten Schweizerischen Rentenanstalt (Swisslife).
Seit den 1860er-Jahren kritisierten Versicherungsmathematiker wie Herrmann Kinkelin oder Johann Jakob Kummer die Organisation und die Finanzierungsmodelle der Hilfskassen, weil sie zu wenig Kapitalreserven besässen und ihren Verpflichtungen langfristig nicht mehr nachkommen könnten. Im Gegenzug sträubten sich die Hilfskassen gegen Kontrollen und lehnten - vor allem in der Romandie - eine staatliche Kranken- und Unfallversicherung ab. In der Tat verschärfte die Einführung der Unfallversicherung (1918) die staatliche Regulierung und die Konkurrenz. Die Zahl der Kassen nahm nach dem Ersten Weltkrieg ab. Einige entwickelten sich zu kommerziellen Versicherern.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin (2006), Risikopolitik im Sozialstaat: Die schweizerische Unfallversicherung (1870–1970), Köln; Muheim David (2000), Mutualisme et assurance maladie (1893–1912). Une adaptation ambigue, Traverse, 2, 79–93; HLS / DHS / DSS: Hilfsvereine; Pensionskassen; Arbeitslosenversicherung ALV.
(12/2014)
1877 nahm das Stimmvolk gegen den Widerstand vieler Industrieller knapp das Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken an, das sogenannte Fabrikgesetz. Damit griff der Bund direkt in die wirtschaftlichen Verhältnisse ein: Er beschränkte die Vertragsfreiheit und die Autonomie der Unternehmer. Im Bereich des regulativen Arbeiterschutzes gehörte die Schweiz nun international zu den Pionieren.
Bereits in den 1860er-Jahren hatten gemeinnützige Kreise und Ärzte mit Untersuchungen auf die misslichen Arbeitsbedingungen, die Gefährdung von Leben und Gesundheit in den Fabriken sowie auf die Verbreitung der Kinderarbeit aufmerksam gemacht. In der Folge dominierte der Schutz der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit der Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter die Debatte um die "soziale Frage". Die totalrevidierte Bundesverfassung von 1874 gab dem Bund schliesslich die Befugnis, Bestimmungen zur Arbeit von Kindern, zur Beschränkung der Arbeitszeit und zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter zu erlassen.
Das eidgenössische Fabrikgesetz, das die Verfassungsnorm umsetzte, schloss in vielen Punkten an die Gesetzgebung jener Kantone an, die die Industriearbeit bereits früher reguliert hatten. So hatte der Kanton Zürich schon 1815 die Arbeit von Kindern eingeschränkt. Wegweisend für die Entwicklung des Arbeiterschutzes war das Gesetz des Kantons Glarus von 1864, das erstmals auch die Beschäftigung von Erwachsenen regelte. Das Fabrikgesetz begrenzte den Normalarbeitstag auf elf Stunden pro Tag, verbot Nacht- und Sonntagsarbeit, die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren und von Frauen einige Wochen vor und nach der Niederkunft. Es verpflichtete die Fabrikbetreiber, Vorschriften zum Schutz der Arbeitenden einzuhalten und machte sie bei Unfällen haftbar. Inspektoren sollten die Einhaltung des Gesetzes kontrollieren. Es galt allerdings nur für Fabriken, nicht aber für die vielen kleinen Gewerbebetriebe, geschweige denn für die Landwirtschaft. 1882 unterstanden erst 134.500 Personen oder etwa 10 Prozent der Berufstätigen der neuen Regelung.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Siegenthaler Hansjörg (ed.) (1997), Wissenschaft und Wohlfahrt. Moderne Wissenschaft und ihre Träger in der Formation des schweizerischen Wohlfahrtsstaates während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Zürich; Gruner Erich (1968), Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert, Bern; HLS / DHS / DSS: Fabrikgesetze.
(12/2014)
Zwischen 1883 und 1889 führte das Deutsche Reich die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die Alters- und Invalidenversicherung für Arbeiterinnen, Arbeiter und andere Lohnabhängige ein. Das neue Modell der Vorsorge wurde bald auch in der Schweiz diskutiert und propagiert. Es markierte den Übergang von einer auf Fürsorge und punktuelle Schadensbehebung bedachten Sozialpolitik zu einer ausbaufähigen Daseinsvorsorge durch eine Sozialversicherung, die die Risiken des Erwerbslebens abdeckte und auf einem individuellen Rechtsanspruch beruhte. Den Ausschlag für die von Reichskanzler Otto von Bismarck angestossenen Neuerungen gaben mehrere Faktoren: ein interventionistisches Staatsverständnis, Probleme der bestehenden Hilfskassen, ungelöste Fragen bezüglich der Unfallverhütung und die Absicht der Regierung, die Arbeiterschaft in den Obrigkeitsstaat zu integrieren und so die Sozialdemokratie zu schwächen.
Die deutsche Krankenversicherung (1883) umfasste die Deckung der Behandlungskosten, Krankentaggeld, Unterstützung für Wöchnerinnen und Sterbegeld. Die Unfallversicherung (1884) deckte ebenfalls die Heilungskosten und sah zusätzlich Massnahmen zur Unfallverhütung vor. Die Alters- und Invalidenversicherung (1889) gewährte bei Erwerbsunfähigkeit respektive bei Erreichen des 70. Lebensjahrs eine bescheidene Rente. Alle drei Versicherungen waren für Personen mit einem jährlichen Einkommen unter 2.000 Reichsmark obligatorisch. Finanziert wurden sie durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie - im Fall der Alters- und Invalidenversicherung - zusätzlich durch staatliche Zuschüsse. Bei der Einführung der Versicherungen griff man auf die bestehenden Krankenkassen zurück oder schuf neue, selbstverwaltete Berufsgenossenschaften (Unfallversicherung) oder Landesversicherungsanstalten (Alters- und Invalidenversicherung).
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin (2007b), Transfer mit Grenzen: das ‚Modell Deutschland‘ in der schweizerischen Sozialstaatsgeschichte 1880–1950, in G. Kreis, R. Wecker (ed.), Deutsche und Deutschland aus Schweizer Perspektiven, 47–66, Basel; Stolleis Michael (2003), Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, Stuttgart; Kott Sandrine (1995), L’état social allemand. Représentations et pratiques, Paris.
(12/2014)
Der Verfassungsartikel, der dem Bund die Kompetenz für die Einrichtung einer obligatorischen Unfall- und Krankenversicherung erteilte, wurde in einer Volksabstimmung vom 26. Oktober 1890 klar angenommen. Er verlagerte Zuständigkeiten von den Kantonen zum Bund und bedeutete einen wichtigen Schritt in Richtung einer nationalen Sozialpolitik. Den Anstoss zum neuen Verfassungsartikel gab die Haftpflichtregelung bei Arbeitsunfällen, die sowohl auf Seiten der Arbeiter- als auch der Unternehmerschaft zu Unzufriedenheit geführt hatte. Die Arbeiter trugen das Risiko, bei einer Klage leer auszugehen. Zudem lag es allein an den Unternehmern, für ihre Angestellten eine Kollektivpolice bei einer Versicherungsgesellschaft abzuschliessen. Das bürgerlich dominierte Parlament beauftragte den Bundesrat 1885, die Einführung einer obligatorischen Arbeiter-Unfallversicherung vorzubereiten. Im Verlauf der Arbeit bezog der Bundesrat eine Krankenversicherung in die Vorlage mit ein.
Der Bundesrat gab mehrere statistische Erhebungen in Auftrag und bestellte Expertengutachten, unter denen Ludwig Forrers Denkschrift herausragt. Der Zürcher Nationalrat, der dem demokratischen Flügel des Freisinns angehörte, befürwortete das Versicherungsprinzip ("Verteilung der Gefahr auf Viele") und die Einrichtung einer obligatorischen und staatlichen Unfall- und Krankenversicherung nach dem Vorbild des Bismarck'schen Modells: "Haftpflicht bedeutet den Streit, Versicherung den Frieden." Der Bundesrat und das Parlament folgten diesem ebenso zukunftsweisenden wie pragmatischen Konzept. Nicht durchsetzen konnte sich dagegen der Vorschlag der vorberatenden Nationalratskommission, die Gesetzgebungsbefugnis des Bunds auch auf "andere Arten der Personenversicherung" auszuweiten und so bereits jetzt die Verfassungsgrundlage für eine Alters-, Invaliden- oder Arbeitslosenversicherung zu schaffen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin (2006), Risikopolitik im Sozialstaat: Die schweizerische Unfallversicherung (1870–1970), Köln; Degen Bernard (1997), Haftpflicht bedeutet den Streit, Versicherung den Frieden: Staat und Gruppeninteressen in den frühen Debatten um die schweizerische Sozialversicherung, in H. Siegenthaler (ed.), Wissenschaft und Wohlfahrt. Moderne Wissenschaft und ihre Träger in der Formation des schweizerischen Wohlfahrtstaates während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 137–154, Zürich.
(12/2014)
Zwischen 1890 und 1947 bekam der schweizerische Sozialstaat erstmals Konturen. Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Unfall- und Krankenkasse von 1890 bedeutete einen ersten Schritt in Richtung einer modernen Sozialpolitik. Doch 1900 lehnten die Stimmberechtigten das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ab. Nur mit grosser Verzögerung gelang es der Politik, Teile der Vorlage zu retten: Elf Jahre später schaffte ein deutlich schlankeres Gesetz, das nur mehr die obligatorische Unfallversicherung vorsah, die Hürde einer weiteren Volksabstimmung. Dieses Muster wiederholte sich mehrmals. Im Rückblick erscheint die Etablierung der Sozialen Sicherheit bis zum Zweiten Weltkrieg als eine lange Experimentierphase, die durch schrittweise, oft minimalistische und dennoch scheiternde Reformversuche geprägt war. Nachhaltige Schübe blieben selbst nach dem Ersten Weltkrieg und dem Landesgeneralstreik (1918) aus, der einen kurzfristigen sozialpolitischen Aktivismus auslöste. Eine hemmende Wirkung hatten nicht zuletzt das direktdemokratische System, die Plebiszite, aber auch die politischen Aushandlungen im Vorfeld der Abstimmungen. So scheiterte auch die erste, überaus moderat ausgestaltete Vorlage für eine Alters- und Hinterlassenenversicherung an einer Volksabstimmung (1931). Erst die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ermöglichten eine neue Dynamik, die schliesslich in der Verabschiedung der AHV (1947) gipfelte.
Diese Entwicklung führte dazu, dass die Soziale Sicherheit in der Schweiz bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg ein hybrides und heterogenes System blieb. Darin spielten nicht nur der Staat (Bund, Kantone, Gemeinden), sondern auch viele private Akteure eine wichtige Rolle, zum Beispiel kommerzielle Versicherungsgesellschaften, karitative und gemeinnützige Organisationen. Die Hauptlast der öffentlichen Wohlfahrt ruhte weiterhin auf der kommunalen Armenfürsorge, die ab der Jahrhundertwende indes neue Strategien im Umgang mit sozialer Not entwickelte.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Studer Brigitte (2012), Ökonomien der sozialen Sicherheit, in P. Halbeisen, M. Müller, B. Veyrasset (ed.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 923–974, Basel; Degen Bernard (2006), Entstehung und Entwicklung des schweizerischen Sozialstaates, Studien und Quellen, 31, 17–48.
(12/2014)
Um die Wende zum 20. Jahrhundert bildete die Armenfürsorge der Gemeinden immer noch das Rückgrat der sozialen Wohlfahrt. In den meisten Kantonen galt nach wie vor das Prinzip der Unterstützung am Heimatort. Dennoch werden um 1900 neue Ansätze zur Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft und zur Bekämpfung der Armut, aber auch zur Kontrolle und Disziplinierung der Unterschichten sichtbar. Unter dem Titel der "communalen Socialpolitik" bauten vor allem die Städte ihre sozialen Leistungen aus. Die Stadt Bern richtete beispielsweise eine Arbeitsvermittlung (1889), eine Armenanstalt (1892) und eine Arbeitslosenkasse (1893) ein. Zudem kurbelte sie den sozialen Wohnungsbau an und subventionierte private Kinderhorte und -krippen (1891/98).
Zur gleichen Zeit plädierte eine neue Generation von Fürsorgeexperten, die sich 1905 in der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz zusammenschlossen, für eine Rationalisierung der Fürsorge nach ausländischen Vorbildern. Leitlinien bildeten dabei die Einzelfallhilfe, die Zentralisierung der Organisation, die Bürokratisierung der Verfahren und die Professionalisierung des Personals. Von Frauen selbst gegründete Soziale Schulen eröffneten Frauen aus der Mittelschicht das Berufsfeld der Fürsorgerin.
Paradigmatisch zeigt sich das neue Fürsorgeverständnis in der meist städtischen Jugendfürsorge. Sie wurde mit den Kinderschutzbestimmungen des Zivilgesetzbuches (1912) und der Institutionalisierung von Aus- und Weiterbildungskursen (ab 1908) ausgebaut und verwissenschaftlicht. So professionalisierte die Stadt Zürich die ärztliche Betreuung der Schulkinder (1905) und reorganisierte das Vormundschaftswesen (1908). Dadurch weitete sich die staatliche Fürsorge von den bedürftigen Kindern auf die "verwahrlosten" und kranken Kinder aus. Die Behörden zogen dabei zunehmend wissenschaftliche Experten bei, insbesondere Ärzte und Heilpädagogen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Matter Sonja (2011), Der Armut auf den Leib rücken: Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900–1960), Zürich; Tabin Jean-Pierre et al. (2010 [2008]), Temps d’assistance. L’assistance publique en Suisse romande de la fin du XIXe siècle à nos jours, Lausanne; Schnegg Brigitte (2007), Armutsbekämpfung durch Sozialreform: Gesellschaftlicher Wandel und sozialpolitische Modernisierung Ende des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Stadt Bern, Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 69, 233–258; Ramsauer Nadja (2000), “Verwahrlost”: Kindswegnahmen und die Entstehung der Jugendfürsorge im schweizerischen Sozialstaat, 1900–1945. Zürich.
(12/2014)
Anlässlich der Weltausstellung in Paris von 1900 gründeten Sozialpolitiker verschiedener europäischer Staaten die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz (IVGA). Sie richtete in Basel das internationale Arbeitsamt ein, das zu einem guten Teil von der Schweiz finanziert wurde. Wie die zahllosen anderen internationalen Kongresse und die internationalen Organisationen und Büros, die um die Jahrhundertwende entstanden, widerspiegelt die Gründung der IVGA die wachsende wirtschaftliche Verflechtung der modernen Industriestaaten und den Ausbau der modernen Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen. Fragen der Sozialen Sicherheit spielten eine wichtige Rolle auf der internationalen Kongressagenda. Experten und Funktionäre debattierten über die öffentliche Wohlfahrtspflege und die private Wohltätigkeit, über Arbeitsunfälle, Versicherungen und die Methoden der Versicherungswissenschaft (Berechnung von Versicherungsrisiken).
Es war kein Zufall, dass die Schweiz sich grenzüberschreitend für den Arbeiterschutz engagierte. Das Fabrikgesetz von 1877, das besondere Schutzbestimmungen für Kinder und Frauen enthielt, galt international als fortschrittlich. Vertreter der Arbeiterschaft und der Industrie sowie der Bundesrat waren gleichermassen daran interessiert, die Schutzbestimmungen - und die Konkurrenzbedingungen - über die Grenzen hinweg zu harmonisieren. Nachdem 1890 ein erster diplomatischer Vorstoss gescheitert war, organisierte der Arbeiterbund 1897 in Zürich einen Kongress für Arbeiterschutz, der die Sozialpolitik grenzüberschreitend koordinieren sollte.
Nach seiner Gründung wirkte das internationale Arbeitsamt in Basel vor allem als Dokumentationsstelle. Daneben spurte die IVGA als private, jedoch regierungsnahe Vereinigung mehrere Konventionen vor, unter anderem den Schutz vor gefährlichen Substanzen und ein Nachtarbeitsverbot für Frauen. Bis zum Ersten Weltkrieg trat sie weiter für den Schutz jugendlicher Arbeiter und die Einführung des 8-Stunden-Tags ein. 1919 gingen viele ihrer Funktionen an die Internationale Arbeitsorganisation über.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Herren-Oesch Madeleine (2009), Internationale Organisationen seit 1865. Eine Globalgeschichte der internationalen Ordnung, Darmstadt; Topalov Christian (1999), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris; Garamvölgyi Judit (1982), Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, in Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift Ulrich Im Hof, 626–646, Bern.
(12/2014)
Am 20. Mai 1900 lehnten die Stimmberechtigten mit knapp 70 Prozent Nein-Stimmen das Bundesgesetz betreffend die Kranken- und Unfallversicherung sowie die Militärversicherung ab. Die Vorlage war von allen Parteien und den Wirtschaftsverbänden mitgetragen worden. Dennoch siegte die heterogene Gegnerschaft, die sich aus liberalen Antizentristen der Westschweiz, Konservativen, privaten Versicherungsgesellschaften und teilweise aus der Bauern- und Arbeiterschaft rekrutierte, an der Urne. Vor allem die antietatistischen Argumente der Kranken- und Hilfskassen, die um ihre Autonomie bangten, verfingen beim Stimmvolk.
Die Vorlage, die die Bundesversammlung im Oktober 1899 mit grosser Mehrheit verabschiedet hatte, ging auf den Entwurf des freisinnigen Nationalrats Ludwig Forrer zurück, der sich an vorderster Front für die Sozialversicherung engagierte. Obwohl sich die komplexe Vorlage mit ihren 400 Artikeln auf Unselbständigerwerbende beschränkte, war sie ein grosser Wurf. Sie sah erstmals ein Versicherungsobligatorium für die meisten Lohnabhänigen vor, den anderen Personen bot sie die Möglichkeit, sich freiwillig zu versichern. Zudem wären auch die Wehrmänner versichert gewesen. Die Versicherung hätte Heilungskosten übernommen sowie Kranken-, Wöchnerinnen- und Sterbegeld ausbezahlt. Die Unfall- und Militärversicherung hätte zusätzlich Invaliden- und Hinterlassenenrenten gesprochen. Finanziert werden sollte die Versicherung durch Bundesbeiträge sowie Prämien der Arbeitnehmer und -geber. Die Durchführung wollte das Parlament neu zu schaffenden öffentlichen und den bestehenden privaten Krankenkassen sowie der zu errichtenden eidgenössischen Unfallversicherungsanstalt übertragen. Als Rechtsmittelinstanz war ein Bundesversicherungsgericht vorgesehen.
Das Verdikt der Stimmberechtigten bereitete dem Traum der umfassenden Risikoabsicherung ein jähes Ende. Für Jahrzehnte blieb der Ausbau der Sozialen Sicherheit nun auf die Politik der kleinen Schritte angewiesen. 1902 nahm immerhin die Militärversicherung ihre Tätigkeit auf. 1912 akzeptierten die Stimmbürger schliesslich eine schlankere Fassung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, die sich auf ein Obligatorium in der Unfallversicherung beschränkte und die Krankenversicherung nicht grundlegend reformierte.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Degen Bernard (1997), Haftpflicht bedeutet den Streit, Versicherung den Frieden: Staat und Gruppeninteressen in den frühen Debatten um die schweizerische Sozialversicherung, in H. Siegenthaler (ed.), Wissenschaft und Wohlfahrt. Moderne Wissenschaft und ihre Träger in der Formation des schweizerischen Wohlfahrtstaates während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 137–154, Zürich.
(12/2014)
Bestrebungen, körperlich geschädigten Soldaten materiell zu unterstützen, reichen in den eidgenössischen Orten und dem europäischen Ausland bis in die Frühe Neuzeit zurück. Im Schweizer Bundesstaat waren seit 1852 und 1875 Militärpensionsregime in Kraft. Um 1887 wurde zusätzlich auf private Initiative eine Unfallversicherung für Teile der Truppen eingerichtet. Parallel dazu arbeitete der Bund an einer breiter abgestützten Lösung im Rahmen einer allgemeinen Kranken- und Unfallversicherung, die sich nicht nur auf die Industriearbeiterschaft, sondern auch auf die Soldaten erstrecken sollte. Der Gesetzesentwurf von 1900 (Lex Forrer) scheiterte aber in der Volksabstimmung. Darauf trennten die Bundesbehörden die unbestrittene Militärversicherung vom kontrovers diskutierten Rest der Vorlage. Schon 1901 wurde das „Bundesgesetz betreffend Versicherung der Militärpersonen gegen Krankheit und Unfall“ verabschiedet und 1902 in Kraft gesetzt. Dies war die Geburtsstunde der ersten Sozialversicherung in der Schweiz.
Mit der eidgenössischen Militärversicherung setzte sich im Umgang mit geschädigten Soldaten das Versicherungs- gegen das Fürsorgeprinzip durch. Der Bund beschränkte Entschädigungsleistungen nun nicht mehr ausschliesslich auf Bedürftige, sondern händigte allen Armeeangehörigen Leistungen aus, je nach Dauer und Schwere der Beeinträchtigung. Die Versicherung galt für Krankheiten und Unfälle, die während des Militärdienstes auftraten, selbst wenn sie nicht direkt mit einer militärischen Aktivität zusammenhingen. Von Leistungen ausgeschlossen waren jedoch Krankheiten, welche die Soldaten bereits vorher hatten und die während der Dienstzeit wiederauftraten oder sich verschlimmerten. Die Versicherungsleistungen beinhalteten eine kostenlose Verpflegung und Behandlung bis zur körperlichen Wiederherstellung, ein Krankengeld und gegebenenfalls eine Invalidenpension für die Soldaten oder ein Sterbegeld beziehungsweise eine Hinterlassenenpension für die Angehörigen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Militärversicherungs-Schriftenreihe, 1, 1976 u. 2, 1979; Maeschi Jürg (2000), Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Bern; Morgenthaler W. (1939), Militärversicherung, in Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, 179-80, Bern.
(12/2014)
Nach einem Vierteljahrhundert angestrengter Debatte nahmen die Stimmberechtigten am 4. Februar 1912 das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) an. Was die Unfallversicherung anbelangte, entsprach das KUVG weitgehend der 1900 an der Urne gescheiterten Lex Forrer. Allerdings war der Kreis der obligatorisch Versicherten enger gezogen und auf Beschäftigte in der Industrie und auf bestimmte Berufssparten begrenzt. Bis in die 1980er-Jahre waren nur etwa die Hälfte der unselbstständig Erwerbstätigen obligatorisch gegen Unfall versichert. Hinzu kam eine wachsende Zahl von freiwillig Versicherten. Auch die Leistungen (Krankenpflege, -geld, Renten, Bestattungsentschädigung) und die Finanzierung der Unfallversicherung entsprachen dem 1900 vorgezeichneten Rahmen. Der Krankenversicherungsteil des Gesetzes verzichtete dagegen auf ein Obligatorium. Nun waren die Kantone ermächtigt, ein solches zu erlassen. Das Engagement des Bundes beschränkte sich auf die Subventionierung und Regulierung der privaten Kassen.
Das neue Gesetz übertrug die Durchführung der Unfallversicherung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva), die 1918 als autonome öffentlich-rechtliche Anstalt ihren Betrieb in Luzern aufnahm. Oberstes Organ der Suva war und ist der Verwaltungsrat, der sich aus Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und des Bundes zusammensetzte und die Direktion wählt. Ebenfalls in die Zuständigkeit der Suva fiel und fällt die Unfallverhütung, die zuvor die Aufgabe der Fabrikinspektoren gewesen war. Bereits früh engagierte sich die Suva zudem im Bereich der medizinischen Rehabilitation, insbesondere mit dem Betreiben einer Bäderheilstätte in Baden (1928).
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin (2006), Risikopolitik im Sozialstaat: Die schweizerische Unfallversicherung (1870–1970), Köln; HLS / DHS / DSS: Unfallversicherung ; Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA.
(12/2014)
Am 19. Dezember 1912 stimmte das Parlament der Schaffung des Bundesamts für Sozialversicherung (BSV) zu, der ersten Bundesstelle, die als Bundesamt bezeichnet wurde. Es war dem Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartement (heute Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) zugeordnet und anfänglich im Gebäude der Nationalbank in Bern untergebracht. Zu den Aufgaben des BSV gehörte der Vollzug des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (KUVG), insbesondere die Aufsicht über die Suva, und die Anerkennung und Subventionierung der Krankenkassen. Zudem war das Amt für weitere Vorarbeiten auf dem Gebiet der Sozialversicherung und für Abkommen mit dem Ausland zuständig. Es war mit sechs regulären Stellen ausgestattet: ein Direktor, ein Adjunkt, ein Experte, ein Mathematiker und zwei Kanzlisten.
Die neue Verwaltungseinheit war die organisatorische Konsequenz der Volksabstimmung vom 4. Februar 1912, in der das KUVG angenommen worden war. Von Anfang an war der Bundesrat besorgt, dass das neue Amt über das nötige versicherungstechnische Wissen verfüge und von "geschulten Versicherungsmännern" geleitet werde. Geprüft - und bald wieder verworfen - wurde deshalb eine Zusammenlegung mit dem Eidgenössischen Versicherungsamt (heute Bundesamt für Privatversicherungen), das seit 1886 die privaten Versicherungsgesellschaften beaufsichtigte. Nach der Absage des Leiters des Versicherungsamts und Mathematikers Christian Moser fiel die Wahl bei der Besetzung des Direktorenpostens schliesslich auf den Versicherungsjuristen Hermann Rüfenacht.
Ein weiterer Grund für die Schaffung eines neuen Amts war der Umstand, dass die Alters- und Invalidenversicherung weiterhin auf der politischen Agenda stand, die "Versicherungsprobleme" also mit der Einführung des KUVG noch keineswegs gelöst waren. Nach der Ansicht des Bundesrats musste der Staat künftig gerüstet sein, um den "sachlich nötigen Ausbau seiner Gesetzgebung" vornehmen und rechtfertigen zu können und die "wirtschaftlichen Konsequenzen" zu erkennen: "Nur dann können die Behörden durchführbare Massregeln mit Energie und Autorität verteidigen, nur dann den zu weit gehenden, unsere Kräfte übersteigenden Forderungen mit sachlichen Gründen entgegentreten."
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Bundesamt für Sozialversicherungen (1988), Geschichte, Aufgaben und Organisation des Bundesamtes fürs Sozialversicherung (Sonderdruck aus der Zeitschrift für die Ausgleichskassen, 1988, Nr. 7–9), Bern; Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Errichtung eines Bundesamtes für soziale Versicherung, 29. Oktober 1912, Bundesblatt, 1912 IV, 501–526.
(12/2014)
Die Schweiz rechnete wie alle anderen europäischen Nationen beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit einem kurzen Waffengang. Auch sozialpolitische Massnahmen zur Abfederung der grassierenden Inflation blieben lange aus. Es bestand weder eine Lohnausfallsentschädigung für Wehrmänner noch eine Preiskontrolle; erst in den letzten beiden Kriegsjahren rationierten die Behörden Grundnahrungsmittel wie Brot und Milch. Zudem weichte der Bundesrat das Fabrikgesetz auf und verfügte Lohnstopps in öffentlichen Betrieben. Die Folgen waren Reallohneinbussen von 25 bis 30 Prozent, eine prekäre Lebensmittelversorgung und Wohnungsnot. Im Sommer 1918 zählte man offiziell 692.000 notstandsberechtigte Personen, etwa ein Sechstel der Bevölkerung. In den Städten waren die Zahlen noch höher. Im Herbst 1918 wurde die geschwächte Bevölkerung zudem von der Spanischen Grippe getroffen, die fast 25.000 Tote forderte, was 0.6 Prozent der Bevölkerung von 1920 ausmachte.
Notmassnahmen ergriffen vor allem die Kantone und Gemeinden. Sie richteten - oft in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Frauenvereinen - Suppenküchen und Arbeiterstuben ein und verteilten Lebensmittel. Der Bund unterstützte vor allem die Arbeitslosenfürsorge. Weil er damit rechnete, dass die Arbeitslosigkeit zunehmen würde, richtete er 1917 einen Fürsorgefonds ein, der durch die Kriegssteuer alimentiert wurde. Mit Gemeinden und Arbeitgebern unterstützte er Personen, die unverschuldet arbeitslos geworden waren. Zusätzlich subventionierte er die bestehenden, oft gewerkschaftlich getragenen Arbeitslosenkassen und begünstigte private Vorsorgeeinrichtungen steuerlich.
Die sich verschlechternde soziale Lage führte zu einer innenpolitischen Polarisierung, zu Protesten und zu Streiks, die im November 1918 im Landesstreik kulminierten. Das Oltener Aktionskomitee, das die Massnahmen der Arbeiterbewegung koordinierte, stellte primär sozialpolitische Forderungen auf: das Frauenstimmrecht, die 48-Stunden-Woche, die Sicherung der Lebensmittelversorgung sowie die - seit 1912 auf politischer Ebene hängige - Einführung einer Alters- und Invalidenversicherung.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Tabin Jean-Pierre et al. (2010 [2008]), Temps d’assistance. L’assistance publique en Suisse romande de la fin du XIXe siècle à nos jours, Lausanne; HLS / DHS / DSS: Weltkrieg, Erster; Grippe.
(12/2014)
Vor 1914 gab es ausserhalb des öffentlichen Sektors nur wenige Pensionskassen und nur eine Handvoll Unternehmen gewährte ihren Angestellten Altersrenten. Das änderte sich ab 1916, als der Bund beschloss, die an Vorsorgeeinrichtungen entrichteten Beträge von der Kriegsgewinnsteuer zu befreien. Diese Steuererleichterung führte insbesondere in der Maschinen- und Metallindustrie zur Gründung einer ganzen Reihe neuer Pensionskassen. Zwischen 1911 und 1930 verzehnfachte sich die Zahl der Kassen (von rund hundert auf über tausend). Hinter diesem Boom verbargen sich allerdings grosse Unterschiede: 1930 waren zwei Drittel der Beschäftigten des öffentlichen Sektors einer Kasse angeschlossen, bei den Arbeitnehmenden des Privatsektors waren es gerade mal zehn Prozent.
Über Steueroptimierungen hinaus trugen die Vorsorgeeinrichtungen der Arbeitgeber auch dazu bei, die Arbeitsbeziehungen nach dem Generalstreik zu beruhigen und die Angestellten an ihre Unternehmen zu binden. Schliesslich lässt sich diese erste Expansionsphase auch durch die Verzögerung und die Hürden bei der Einrichtung der AHV erklären. Ab der Zwischenkriegszeit trat die Lobby der Privatvorsorge, die sich 1922 im Schweizerischen Verein der Unterstützungskassen und Stiftungen für Alter und Invalidität (SVUSAI) zusammenschloss, als wichtige Akteurin bei den Debatten über die Renten auf.
Die Lebensversicherer besetzten in diesen Debatten ebenfalls eine strategische Position. Mit ihren Kompetenzen in Versicherungsmathematik (Methode zur Berechnung der Versicherungsrisiken) berieten sie den Bund bei den ersten AHV-Projekten. Ab den 1920er-Jahren entwickelten sich ihre Gesellschaften dank Gruppenverträgen (für Unternehmen, die Rentenleistungen anbieten wollten, ohne ihre eigene Pensionskasse zu betreiben) auch auf dem Vorsorgemarkt weiter. Damals hatte die Privatvorsorge bereits eine beachtliche finanzielle Tragweite: Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs beliefen sich die Reserven der Pensionskassen bereits auf mehr als ein Viertel des Bruttoinlandprodukts.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Leimgruber Matthieu (2006), La politique sociale comme marché. Les assureurs vie et la structuration de la prévoyance vieillesse en Suisse (1890–1972), Studien und Quellen, 31, 109–139, Zürich; HLS / DHS / DSS: Pensionskassen.
(12/2014)
Gestützt auf den Versailler Vertrag und im Rahmen des Völkerbunds wurde 1919 die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) gegründet. Die IAO und das ihr zugehörige Internationale Arbeitsamt, die ihren Sitz bis heute in Genf haben, waren nach dem Ersten Weltkrieg federführend im internationalen Arbeiterschutz und in der transnationalen Sozialpolitik. Der Gründung der IAO lag die Überlegung zugrunde, dass eine dauerhafte Friedensordnung nur durch die Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Staat errichtet werden konnte. In der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, die als regierungsnahe Vorläuferorganisation der IAO gilt, hatte die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Anders in der IAO: Hier waren und sind alle nationalen Delegationen aus zwei Behördendelegierten sowie je einem Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter zusammengesetzt.
Noch bevor die IAO ihre Tätigkeit aufnahm, fand in Washington die erste internationale Arbeitskonferenz statt. Sie verabschiedete zwölf Entwürfe von Übereinkommen, die unter anderem die Einführung der 48-Stunden-Woche, Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit sowie den Schutz von Frauen, Müttern und Jugendlichen in der Industrie vorsahen. Für die Schweiz waren diese Beschlüsse insbesondere deshalb bedeutsam, weil damit die Forderung nach finanzieller Absicherung der Mutterschaft auf die politische Agenda kam. Aus finanziellen Überlegungen lehnten Bundesrat und Parlament zwar die Ratifizierung der entsprechenden Konvention ab, im Gegensatz zu andern Sonderschutzbestimmungen für Frauen. Das Bundesamt für Sozialversicherung erhielt jedoch immerhin den Auftrag, die Integration der Mutterschafts- in die Krankenversicherung zu prüfen. Die Reform versandete aber Mitte der 1920er-Jahre. Eine weitere Gesetzesvorlage erlitt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg das gleiche Schicksal. Generell war die Schweiz bis zum Zweiten Weltkrieg äusserst zurückhaltend bei der Ratifizierung der IAO-Konventionen, die in den meisten Fällen die soziale Absicherung erweiterten. Nur drei der total 15 Übereinkommen wurden übernommen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Herren-Oesch Madeleine (2009), Internationale Organisationen seit 1865. Eine Globalgeschichte der internationalen Ordnung, Darmstadt; Wecker Regina, Studer Brigitte, Sutter Gaby (2001), Die ‚schutzbedürftige Frau‘. Zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung, Zürich; Kneubühler Helen Ursula (1982), Die Schweiz als Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, Bern; HLS / DHS / DSS: Internationale Arbeitsorganisation ILO.
(12/2014)
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg hatten Bundesrat und Parlament die Schaffung einer Arbeitslosenversicherung abgelehnt. Auch das Bundesgesetz über die Beitragsleistung von 1924 sah keine obligatorische Versicherung vor. Der Bund beschränkte sich vielmehr darauf, Beiträge an die bestehenden öffentlichen und privaten Arbeitslosenkassen auszurichten. Die sozialpolitische Aufgabe der Arbeitslosenunterstützung wurde damit an insgesamt 61 Kassen delegiert, die - grösstenteils von den Gewerkschaften getragen - 1923 rund 185.000 Personen versicherten.
Diese Regelung, die nur zehn Prozent der Erwerbstätigen umfasste, schloss weitgehend an die Praxis der bestehenden Arbeitslosenkassen und der Gemeinden an. 1884 hatte der Schweizerische Typographenbund die erste Arbeitslosenkasse gegründet; in weiteren Berufsbranchen wurden ebenfalls Kassen eingerichtet. Nach der Jahrhundertwende gingen einzelne Kantone dazu über, solche Kassen nach dem Vorbild der belgischen Stadt Gent zu subventionieren. Der Bund förderte seinerseits ab 1909 die Arbeitsvermittlung. Doch eine Versicherungslösung, wie sie die Arbeiterschaft forderte, schoben Parlament und Bundesrat auf die lange Bank. In Erwartung steigender Arbeitslosenzahlen bauten Gemeinden, Kantone und Bund ab 1917 jedoch die Fürsorge für bedürftige Stellenlose aus. Parallel dazu beteiligte sich der Bund am Genter System der Kantone. Dieses Finanzierungssystem wurde nach der Aufhebung der übrigen Krisenmassnahmen weitergeführt und im Gesetz von 1924 verankert.
Dieses Gesetz führte zu einem - wenn auch bescheidenen - Aufschwung der Arbeitslosenkassen. 1936 versicherten 204 Kassen 552.000 Personen. Damit waren erst 28 Prozent der Erwerbstätigen versichert. Immerhin hatte bis dahin etwa die Hälfte aller Kantone die Versicherung für obligatorisch erklärt. Geschwächt wurden hingegen die gewerkschaftlichen Kassen, die gemäss der Regelung von 1924 im Vergleich zu öffentlichen und paritätischen Kassen geringere Beiträge vergütet bekamen. Das war von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit indes beabsichtigt.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Tabin Jean-Pierre, Togni Carola (2013), L’assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924-1982), Lausanne. HLS / DHS / DSS: Arbeitslosenversicherung ALV.
(12/2014)
Am 6. Dezember 1925 wurden die Stimmberechtigten zum ersten Mal an die Urne gerufen, um über eine AHV zu entscheiden. Zwei Drittel der stimmenden Männer und 16 ½ Stände befürworteten die Verfassungsgrundlage für die Einführung einer obligatorischen AHV. Zudem erhielt der Bund die Befugnis, später auch die IV einzuführen. Nach dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz von 1912 und dem Rahmengesetz zur Arbeitslosenversicherung von 1924 war dies die nächste Etappe zur Realisierung einer Sozialversicherung, deren Grundlage nicht mehr die Fürsorge, sondern individuelle Rechtsansprüche des Versicherten bildeten.
Linksbürgerliche Kreise und Teile der Arbeiterbewegung hatten unter dem Eindruck der Bismarck'schen Sozialversicherung die Einführung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHIV) bereits in den 1880er-Jahren gefordert, so etwa bei der Debatte über die Verfassungsgrundlage für das spätere KUVG. 1912 stand die AHIV definitiv auf der Traktandenliste des Parlaments, allerdings verzögerte der Kriegsausbruch die Behandlung. 1918 war die AHIV im Grundsatz unbestritten. Selbst die bürgerlichen Parteien bekannten nun Interesse am Sozialstaat; zudem hofften sie, Konzessionen an die Linke würden die angespannte Lage nach dem Landesstreik entschärfen. 1919 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft.
Der sozialpolitische Aufbruch währte indes nur kurz. Angesichts der Nachkriegskrise stellte der erstarkende Bürgerblock die Finanzierungsweise in Frage, die der Bundesrat vorschlug. Strittig blieb insbesondere die Frage, ob zur Finanzierung der AHIV auch direkte Steuern erhoben werden sollten, wie dies etwa die am 24. Mai 1925 verworfene Initiative des freisinnigen Nationalrats Christian Rothenberger vorsah. Um das Scheitern des Projekts zu verhindern, schlug der Bundesrat unter Federführung von Edmund Schulthess vor, auf die IV zu verzichten und die Vorlage in umstrittenen Punkten zu entschlacken. Das Parlament stimmte diesem Kompromiss zu, auch wenn es sich die spätere Realisierung der IV vorbehielt. Der neue Artikel 34quater machte kaum verbindliche Aussagen über die Finanzierung, die Leistungen und die Organisation der neuen Versicherungszweige. Diese Fragen mussten auf dem Weg der Gesetzgebung geklärt werden.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Pellegrini Luca (2006), L’assurance vieillesse, survivants et invalidité : ses enjeux finanicer entre 1918 et 1925, Studien und Quellen, 31, 79–107; Lasserre André (1972), L'institution de l'assurance-vieillesse et survivants (1889–1947), in R. Ruffieux (ed.), La démocratie référendaire suisse au 20ème siècle, 259–326, Fribourg; HLS / DHS / DSS: Altersvorsorge.
(12/2014)
Am 6. Dezember 1931 lehnten die Stimmberechtigten mit 60 Prozent Nein-Stimmen die erste AHV-Vorlage ab, welche die 1925 im Grundsatz beschlossene Alters- und Hinterlassenenversicherung realisiert hätte. Für die Neue Zürcher Zeitung bedeutete das Verdikt eine "katastrophale Niederlage" für die Sache des Sozialstaats. Dabei war die abgelehnte Vorlage überaus bescheiden ausgestaltet. Sie bezweckte, wie der Bundesrat formulierte, lediglich eine "Mindestfürsorge". Sie sah ein Versicherungsobligatorium, einheitliche Renten (200 Franken pro Jahr ab dem 66. Altersjahr) sowie Zuschüsse für Bedürftige vor. Die Finanzierung nach dem Umlageverfahren beruhte auf Lohnprozenten sowie auf Abgaben auf Alkohol und Tabak. Organisatorisch war eine dezentrale Struktur mittels kantonaler Versicherungskassen geplant. Die Kantone hätten zudem die Befugnis erhalten, Ergänzungsversicherungen einzurichten, sofern diese nicht mit der privaten Berufsvorsorge kollidierten. Fünf Kantone verfügten 1931 bereits über solche Kassen.
Trotz Kritik seitens der Sozialdemokratischen Partei am sozialpolitischen Minimalismus der Vorlage und der eher abwartenden Haltung in Wirtschaftskreisen hatte die Vorlage die Zustimmung der grossen Parteien und der Verbände gefunden. Den Gegnern der AHV, die gezielt antizentralistische und antimodernistische Reflexe bedienten, kam indes die aufziehende Weltwirtschaftskrise entgegen. Ähnlich wie bei der Ablehnung der Lex Forrer (1900) bildeten sie eine überaus heterogene Koalition: Liberalkonservative aus der Westschweiz und Bauernvertreter zogen gegen den drohenden "Etatismus" und angeblich überhöhte Versichertenbeiträge ins Feld, während die Katholisch-Konservativen in einer Volksversicherung eine Schwächung der Selbstverantwortung und der privaten Wohlfahrt sahen. Kurz vor dem Abstimmungstermin präsentierte das Referendumskomitee eine Fürsorgeinitiative, die eine auf dem Bedürftigkeitsprinzip beruhende Alternative zur AHV ins Spiel brachte. Die Ablehnung der AHV-Vorlage hatte zur Folge, dass die Linderung der Altersarmut, soweit sie nicht durch private oder kantonale Versicherungen abgedeckt wurde, bis nach dem Zweiten Weltkrieg Sache der Gemeindefürsorge blieb.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Lengwiler Martin (2003), Das Drei-Säulen-Konzept und seine Grenzen: private und berufliche Altersvorsorge in der Schweiz im 20. Jahrhundert, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 48, 29–47; HLS / DHS / DSS: Altersvorsorge.
(12/2014)
Die Weltwirtschaftskrise stellte den Staat vor eine grosse Herausforderung. Die Krise traf die Schweiz, die in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre einen Aufschwung erlebt hatte, vergleichsweise spät. Dafür liess die Konjunkturerholung bis 1937 auf sich warten. Die Krise führte zu einem Rückgang des Volkseinkommens um fast 20 Prozent. Im Winter 1936 stieg die Arbeitslosigkeit auf sieben Prozent der Erwerbstätigen, in Industriegegenden sogar noch höher. Zusätzlich verschärft wurde die Lage der Bevölkerung durch die deflationistische Wirtschaftspolitik der bürgerlichen Parteien und Verbände. Sie hielten an der Goldparität des Schweizer Frankens fest, betrieben eine restriktive Haushalt- und Steuerpolitik, kürzten die Löhne und griffen nur selektiv in die Wirtschaft ein - beispielsweise zu Gunsten der Landwirtschaft. Die bürgerliche Seite bekämpfte eine aktive Ausgabenpolitik (deficit spending), wie es die 1935 an der Urne gescheiterte Kriseninitiative des Gewerkschaftsbunds verlangte.
Die Krise und die zögerliche Krisenpolitik zeitigten deutliche Folgen: Die Zahl der unterstützungsbedürftigen Personen stieg auf fast 20 Prozent der Bevölkerung. In Neuenburg und andern Städten verdoppelte sich der Fürsorgeetat zwischen 1929 und 1937. Betagte oder Personen mit Behinderungen, die über geringe Ressourcen verfügten, wurden besonders stark getroffen. Wie in der Kriegs- und Nachkriegszeit richteten die Städte Suppenküchen, Arbeiterstuben und Notunterkünfte ein. Nach wie vor war nicht einmal ein Drittel der erwerbstätigen Männer und ein Fünftel der erwerbstätigen Frauen gegen Arbeitslosigkeit versichert. Dementsprechend trieb die Krise die Ausgaben - und Mitgliederzahlen - der Arbeitslosenkassen in die Höhe. Der Bund nahm Ende 1931 die - 1924 eingestellte - Unterstützung für ausgesteuerte Stellensuchende wieder auf, überliess jedoch die Hauptlast der Arbeitslosenhilfe den Kantonen und Gemeinden. Erst unter dem Eindruck der Kriseninitiative der Linken beteiligte er sich an Arbeitsbeschaffungsmassnahmen, deren Wirkungen indes bis nach der Abwertung des Schweizer Frankens im September 1936 und dem allmählichen Wiederaufschwung auf sich warten liessen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Müller Margrit, Woitek Ulrich (2012), Wohlstand, Wachstum und Konjunktur, in P. Halbeisen, M. Müller, B. Veyrasset (ed.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 91–222, Basel; Tabin Jean-Pierre et al. (2010 [2008]), Temps d’assistance. L’assistance publique en Suisse romande de la fin du XIXe siècle à nos jours, Lausanne; HLS / DHS / DSS: Weltwirtschaftskrise.
(12/2014)
1935 beschloss der amerikanische Kongress den Social Security Act (SSA), der den Take-off der Sozialen Sicherheit in den USA markiert. Die öffentliche Wohlfahrt war in den USA bis in die 1930er-Jahre nur rudimentär ausgebildet gewesen. Abgesehen von der Vorsorge für Kriegsveteranen, kannten lediglich einige wenige Bundesstaaten Arbeitslosen- oder Altersversicherungen. Nur 15 Prozent der Beschäftigten waren bei privaten Pensionskassen versichert. Der SSA war Teil des New Deal, mit dem Präsident Franklin D. Roosevelt die Folgen der Weltwirtschaftskrise - Rückgang der Beschäftigung und Massenelend - lindern, die Wirtschaft ankurbeln und die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung reformieren wollte. Ferner ergriff er Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zur Stabilisierung des Bankensektors sowie zur Kontrolle der Preise und Arbeitsverhältnisse.
Der SSA umfasste 1935 eine Altersversicherung sowie Zuschüsse an bundestaatliche Hilfsprogramme; 1939 kam eine Hinterbliebenen-, 1955 eine Invalidenversicherung hinzu. Die Old Age Insurance (OAI) beruhte auf dem Umlageverfahren, das keine Reservebildung nötig machte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie diesbezüglich zum Modell für Rentenversicherungen in zahlreichen andern Staaten. Finanziert wurde die OAI über Lohnabzüge, die je zur Hälfte von den Arbeitnehmern und -gebern aufzubringen waren, womit die angestrebte Versöhnung der Klassen deutlich werden sollte. Der SSA wurde schrittweise umgesetzt: Bis 1937 wurden die Versichertenausweise ausgeteilt und der Verwaltungsapparat aufgebaut, 1940 die ersten Renten ausgeschüttet. Die Konsolidierung dauerte indes bis 1949. Nach und nach wurde der Kreis der Beitragspflichtigen ausgeweitet. Die SSA hatte keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung komplementärer Vorsorgestrategien (berufliche Vorsorge), da ihre Leistungen - wie später bei der schweizerischen AHV - nur den Grundbedarf deckten.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Website Social Security Administration, Social Security History: www.ssa.gov/history.
(12/2014)
Der Zweite Weltkrieg bedeutete auf den ersten Blick einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte der Sozialen Sicherheit in der Schweiz. Zwischen 1938 und 1944 stieg der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandprodukt von 4.7 auf 6.9 Prozent - ein Stand, der erst Mitte der 1950er-Jahre wieder erreicht werden sollte. Anders als im Ersten Weltkrieg deckte nun eine Lohn- und Verdienstersatzordnung (LVEO) kriegsspezifische Erwerbsrisiken ab und trug wesentlich zur Vermeidung sozialer Konflikte und zur Stärkung der nationalen Solidarität bei. Organisatorisch und finanziell bildete sie die Grundlage für die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die 1947 dem Prinzip der obligatorischen Volksversicherung zum Durchbruch verhalf.
Allerdings blieb der sozialpolitische Aufbruch während und nach dem Zweiten Weltkrieg bescheiden. So ging die Sozialleistungsquote nach dem Krieg wieder zurück, um erst 1949 erneut anzusteigen. Auch blieb die Erweiterung der Sozialwerke auf die AHV beschränkt, die zudem äusserst bescheidene Renten vorsah und so der Berufsvorsorge der Unternehmen breiten Raum liess. Nach wie vor bestand zum Beispiel keine obligatorische Kranken- oder Arbeitslosenversicherung. Die Mutterschaftsversicherung und Familienzulagen erhielten 1945 zwar eine Verfassungsgrundlage, die Einführung verzögerte sich jedoch um Jahrzehnte. Auch bezüglich der Organisation zeigten sich deutliche Kontinuitäten. Nach wie vor war der Zentralisierungsgrad gering; wichtige Versicherungszweige beruhten auf föderalistischen und dezentralen Strukturen (Ausgleichskassen, private Versicherungseinrichtungen) oder auf dem Prinzip der Freiwilligkeit (Krankenversicherung, berufliche Vorsorge).
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu, Lengwiler Martin (ed.) (2009), Umbruch an der ‚inneren Front‘. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz 1938–1948, Zürich; HLS / DHS / DSS: Weltkrieg, Zweiter.
(12/2014)
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erhielt die finanzielle Absicherung der Wehrmänner und ihrer Familien erste Priorität. Im Ersten Weltkrieg hatte das Fehlen eines Auffangnetzes massgeblich zur Verschärfung der sozialen Spannungen beigetragen, weil Militärdienstleistende nebst dem Sold über kein Einkommen verfügten. Auch nach dem Krieg war der Staat nicht verpflichtet, den Dienstleistenden den ausgefallenen Lohn zu ersetzen. Die Privatwirtschaft kannte je nach Arbeitnehmerkategorie und Branche unterschiedliche Regelungen. Am 20. Dezember 1939 beschloss der Bundesrat deshalb die Einführung einer Lohnausfallsentschädigung. Diese wurde 1940 zur Lohn- und Verdienstersatzordnung (LVEO) erweitert, die auch Selbstständige einbezog. Die Versicherung, die über Beiträge der Arbeitnehmer und -geber (je 2 Prozent des Lohns) sowie des Bundes und der Kantone finanziert wurde, sicherte verheirateten Wehrmännern bis zu 90 Prozent des Einkommens. Für Ledige blieb die Leistung allerdings bescheiden. Als Konzession an die Arbeitgeber liess der Bundesrat die Versicherung grösstenteils über Ausgleichskassen der Verbände abwickeln. Nur der Zentrale Ausgleichsfonds (ZAF), der die Rechnungen der einzelnen Kassen ausglich, war eine Bundesinstitution.
Die LVEO war nach der Unfallversicherung der zweite obligatorische Versicherungszweig in der Schweiz. Sie erfreute sich rasch grosser Popularität. Schon bald wurde sie als Modell für die AHV gehandelt. Die LVEO schützte indes nicht nur vor Erwerbsausfall und Armut. Ihre vergleichsweise grosszügige Ausgestaltung zielte auch darauf ab, den Anreiz für verheiratete Frauen zu verringern, erwerbstätig zu werden. Die LVEO trug damit wesentlich zur Stabilisierung bürgerlicher Rollenmuster und Familienvorstellungen bei.
Bis 1947 schüttete die LVEO insgesamt 1640 Mio. Franken aus. Zugleich stiegen die Überschüsse des ZAF auf 1165 Mio. Franken. Der Grossteil dieser Mittel sollte 1947 das "Startkapital" der AHV abgeben, was die Realisierungschance des neuen Sozialwerks deutlich erhöhte. Die LVEO finanzierte sich bis zu ihrer Reorganisation 1958/61 durch eigene Reserven und Bundesbeiträge.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2009), Schutz für Soldaten nicht für Mütter. Lohnausfallentschädigung für Dienstleitende und Sozialversicherungen in der Schweiz, in M. Leimgruber, M. Lengwiler (ed.), Umbruch an der ‚inneren Front‘. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz 1938–1948, 75–99, Zürich; HLS / DHS / DSS: Erwerbsersatzordnung EO.
(12/2014)
Im November 1942 erschien im Vereinigten Königreich der Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services. Kurz nach der Schlacht von El Alamein, dem ersten grossen Sieg der Alliierten über die deutsche Wehrmacht, bildete dieses Dokument eine wichtige Waffe der Propaganda. Bald waren über 600.000 Exemplare abgesetzt. Als Verfasser zeichnete der Ökonom und Sozialstaatsexperte William Henry Beveridge, der im Auftrag der Regierung die sozialen Sicherungssysteme untersucht hatte. Er skizzierte ein Modell der Sozialen Sicherheit, bei dem alle Staatsbürger einen wöchentlichen Beitrag an eine nationale Versicherungseinrichtung leisteten und dafür gegen Daseinsrisiken wie Krankheit, Invalidität oder Arbeitslosigkeit abgesichert wurden. Es sei Aufgabe des Staats, so Beveridge, den Bürgerinnen und Bürgern von der Wiege bis zur Bahre ("from cradle to the grave") beizustehen und die fünf "Hauptübel" (giant evils) zu bekämpfen: Not, Krankheit, Unwissenheit, Verelendung (squalor) und Beschäftigungslosigkeit (idleness). Beveridges Vorschläge zur Ausdehnung und Zusammenfassung der Sozialwerke zu einer umfassenden Volksversicherung, die auf einer nationalen Risikogemeinschaft beruhte, flossen direkt in die Reformprogramme der Labour-Regierung ein, die im Sommer 1945 die Koalitionsregierung Churchills ablöste. Innert kurzer Zeit wurden die Sozialversicherungen ausgebaut und Lücken im Vorsorgesystem geschlossen. 1948 nahm ein nationaler Gesundheitsdienst (National Health Service) seine Tätigkeit auf. Diese Reformen waren eingebettet in umfassende Planungs- und Verstaatlichungsprogramme.
Beveridges Wohlfahrtsmodell stiess auch in der Schweiz auf grosses Interesse. Dabei trat allerdings rasch die Betonung der nationalen Eigenheiten in den Vordergrund. So kam der "Bohren-Bericht" des Bundesamts für Sozialversicherung vom Mai 1943 zum Schluss, dass der Beveridge-Plan, ganz abgesehen vom Finanzbedarf, weder mit der föderalistischen Staatsordnung der Schweiz noch mit der Einbindung nicht-staatlicher Akteure kompatibel sei. Die Diskussion um den Ausbau der Sozialen Sicherheit, die in der Schweiz ebenfalls 1942 einsetzte, blieb denn auch von vornherein auf einzelne Vorsorgezweige begrenzt, insbesondere auf die AHV und den Familienschutz.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu, Lengwiler Martin (ed.) (2009), Umbruch an der ‚inneren Front‘. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz 1938–1948, Zürich; Monachon Jean-Jacques (2002), Le plan Beveridge et les débats sur la sécurité sociale en Suisse entre 1942 et 1945, in H.-J. Gilomen, S. Guex, B. Studer (ed.), De l’assistance à l’assurance sociale. Ruptures et continuités du Moyen Age au XXe siècle, 321–329, Zürich.
(12/2014)
Am 25. November 1945 nahmen die Stimmberechtigten den Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament zur Volksinitiative "Für die Familie" an. Der neue Art. 34quinquies verankerte den Familienschutz in der Bundesverfassung und gab dem Bund die Kompetenz, auf dem Gebiet der Familienausgleichskassen gesetzgeberisch tätig zu werden, eine Mutterschaftsversicherung einzuführen und den Siedlungs- und Wohnungsbau zugunsten von Familien zu unterstützen. Demgegenüber hätte die zurückgezogene Initiative die Familie explizit zur "Grundlage von Staat und Gesellschaft" erklärt und vom Bund eine ganz auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtete Wirtschafts- und Sozialpolitik verlangt. Auch sie zählte dazu die Einrichtung von Ausgleichskassen, die Familien oder Kinderzulagen ausrichteten.
Mit dem Volksbegehren "Für die Familie" griff die Katholisch-konservative Partei mit einem sozialpolitischen Entwurf in die Diskussion um die Nachkriegsordnung ein, der sich stark an der katholischen Soziallehre orientierte. Indem sie die "natürliche Einheit" der Familie und die traditionelle Rollenteilung zwischen Frauen und Männern in den Vordergrund stellte, beanspruchte die Initiative, eine Alternative zu der von der Linken und vom Freisinn geforderten AHV zu bieten. Angesichts der sinkenden Geburten- und steigenden Scheidungsraten hatte der Familienschutzgedanke in den 1930er-Jahren allerdings weit über das katholische Milieu hinaus Auftrieb erhalten, etwa in der Familienschutzkommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, der auch Vertreterinnen des Bunds Schweizerischer Frauenvereine angehörten. Auch die Zahl der Familienausgleichskassen hatte bereits vor dem Kriegsende zugenommen.
Die sozialpolitischen Postulate, die im Januar 1945 angenommen wurden, blieben in der Folge Stiefkinder des Sozialstaats. Die Familienausgleichskassen wurden weitgehend kantonal und privat geregelt. Erst 2006 schuf ein Bundesgesetz die Grundlage für eine Harmonisierung. Vorstösse für eine Mutterschaftsversicherung scheiterten 1984, 1987 und 1999. Erst 2004 kam eine Lösung im Rahmen der Erwerbsersatzordnung zustande.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Schumacher Beatrice (2009), Familien(denk)modelle. Familienpolitische Weichenstellungen in der Formationsphase des Sozialstaats (1930–1945), in M. Leimgruber, M. Lengwiler (ed.), Umbruch an der ‚inneren Front‘. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz 1938–1948, 139–164, Zürich; Hauser Karin (2004), Die Anfänge der Mutterschaftsversicherung. Deutschland und Schweiz im Vergleich, Zürich; Studer Brigitte (1997), Familienzulagen statt Mutterschaftsversicherung? Die Zuschreibung der Geschlechterkompetenzen im sich formierenden Schweizer Sozialstaat, 1920–1945, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 47, 151–170; HLS / DHS / DSS: Mutterschaft; Familienzulagen.
(12/2014)
Am 6. Juli 1947 hiessen die Stimmberechtigten die Schaffung der AHV gut. Gleichentags nahmen sie die revidierten Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung an, die dem Bund das Recht gaben, im Gesamtinteresse des Landes in die Wirtschaft einzugreifen. Ebenfalls verankerten sie die Mitwirkung der Wirtschaftsverbände. Beide Beschlüsse legten die Grundlage für den Basiskompromiss der Nachkriegszeit.
Das neue Sozialwerk sah das Rentenalter 65 für beide Geschlechter, die Finanzierung über Beiträge von Arbeitnehmern und -gebern sowie von Bund und Kantonen sowie nach Beitragsleistungen abgestufte Alters-, Witwen- und Waisenrenten vor. Die Renten wurden bescheiden gehalten, damit sie nicht die private Vorsorge konkurrenzierten (einfache Altersrente: 40 bis 125 Franken im Monat bei einem durchschnittlichen Einkommen in der Industrie von 745 Franken). Für die Generation, die das Rentenalter bereits erreicht hatte, waren bedürfnisabhängige Übergangsrenten vorgesehen. Organisatorisch übernahm die AHV das dezentralisierte System der Verbands- und Kantonsausgleichskassen, das sich bei der Lohn- und Verdienstausfallersatzordnung (LVEO) bewährt hatte.
Die AHV war ein Kind des politischen Aufbruchs, der 1942/43 auch die Schweiz erfasste. Der Sieg der Alliierten zeichnete sich ab, mit dem Beveridge-Report kamen neue sozialpolitische Optionen auf den Tisch. 1942 hatte eine von der Linken und dem Freisinn getragene Volksinitiative verlangt, die LVEO in die AHV umzuwandeln. Nach anfänglichem Zögern setzte der Bundesrat Anfang 1944 eine Expertenkommission ein und präsentierte dem Parlament zwei Jahre später einen Gesetzesentwurf. Gestützt auf seine Vollmachten, kam er im Oktober 1945 zudem der Forderung des Gewerkschaftsbunds nach und lenkte die LVEO-Überschüsse provisorisch in die Altersvorsorge um. Das Parlament bestätigte später diesen Beschluss, der zugleich das Finanzierungsproblem der AHV löste. Das eigentliche AHV-Gesetz konnte im Parlament auf eine grosse Mehrheit zählen. Dennoch ergriff wie schon bei der AHV-Vorlage von 1931 eine Koalition aus Westschweizer Liberalen, Katholisch-Konservativen und Wirtschaftsvertretern das Referendum. Dieses Mal lag der Ja-Anteil der Stimmenden indes bei stolzen 80 Prozent.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Luchsinger Christine (1995), Solidarität, Selbständigkeit, Bedürftigkeit: der schwierige Weg zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in der AHV: 1939-1980, Zürich; Luchsinger Christine (1994), Sozialstaat auf wackligen Beinen. Das erste Jahrzent der AHV, in J.-D. Blanc, C. Luchsinger (ed.), achtung: die 50er Jahre! Annäherungen an eine widersprüchliche Zeit, 51–69, Zürich; HLS / DHS / DSS: Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV.
(12/2014)
Die Sozialversicherungen blieben bis zum Zweiten Weltkrieg relativ schwach entwickelt. Zu sozialpolitischen Durchbrüchen kam es erst nach Ausbruch des Krieges. Noch 1931 scheiterte ein erster Versuch, eine staatliche AHV einzuführen, an föderalistischen Bedenken gegen zentralstaatliche Einrichtungen. Die private Vorsorge erlebte dagegen in der Zwischenkriegszeit einen Aufschwung.
Die Jahrzehnte nach 1945 waren durch die sukzessive Einführung neuer Versicherungszweige und -obligatorien geprägt: die AHV (1948), die IV (1960), die Ergänzungsleistungen (1966), die Arbeitslosenversicherung (1976) und die berufliche Vorsorge (1985). Reformen fanden auch in der Sozialhilfe statt. Zwischen 1950 und 1990 nahm die Soziallastenquote (Quotient aus Sozialversicherungseinnahmen und Bruttoinlandprodukt), die Aufschluss gibt über die relative Belastung der Volkswirtschaft durch Sozialversicherungseinnahmen, denn auch deutlich zu. 1950 betrug die Quote zehn Prozent, um 1973 auf 15 und bis 1990 auf 21 Prozent zu steigen.
Der Ausbau des Sozialstaats fand zunächst vor dem Hintergrund der Hochkonjunktur der Nachkriegszeit statt, die von hohen Wachstumsraten, steigenden Löhnen, Vollbeschäftigung und einer Erweiterung der Staatstätigkeit geprägt war. Das Wachstum kam Mitte der 1970er-Jahre vorübergehend zum Erliegen. Die Zeit bis 1990 war dann von wiederholten konjunkturellen Ab- und Aufschwüngen gezeichnet. Auf Seite der bürgerlichen Parteien, der Wirtschaft und des Gewerbes nahm in dieser Zeit die Skepsis gegenüber einem weiteren Ausbau der Sozialwerke zu. Die Konsolidierung und punktuelle Reformen der bestehenden Sozialwerke rückten nun ins Zentrum.
Trotz der historisch einmaligen Expansion blieb die Soziale Sicherheit in der Schweiz lange lückenhaft. Die Soziallastenquote nahm sich 1990 im internationalen Vergleich bescheiden aus. Für einzelne Versicherungszweige gab es bis in die 1970er-Jahre hinein nur Minimallösungen, etwa für die Arbeitslosenversicherung. Im Bereich der Krankenversicherung fehlte ein Obligatorium, bei der Mutterschaftsversicherung und den Familienzulagen, die im Prinzip 1945 beschlossen worden waren, verzögerte sich die Einführung um Jahrzehnte.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Studer Brigitte (2012), Ökonomien der sozialen Sicherheit, in P. Halbeisen, M. Müller, B. Veyrasset (ed.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 923–974, Basel.
(12/2015)
Am 22. Mai 1949 lehnte eine Mehrheit der Stimmenden eine Ergänzung des Tuberkulosegesetzes von 1928 ab. Die Vorlage von Bundesrat und Parlament sah in erster Linie die periodische Untersuchung der Bevölkerung auf der Basis der damals modernen Schirmbildtechnik vor. Sie erlaubte, im Massensuchverfahren rasch und zuverlässig infizierte, jedoch noch nicht erkrankte Personen - zeitgenössisch oft als "Streuer" bezeichnet - zu identifizieren. Der politische Widerstand aus bürgerlichen Kreisen, der zum Referendum führte und die Vorlage zu Fall brachte, richtete sich aber nicht nur gegen den Untersuchungszwang und die damit verbundenen Kosten, sondern auch gegen den Umstand, dass die Vorlage gering verdienende Bevölkerungsschichten obligatorisch gegen Krankheit versichert hätte.
Bisher hatten die Krankenversicherer - neben der eigentlichen Krankenversicherung - freiwillige Tuberkuloseversicherungen angeboten. Der Bund unterstützte diese mit Beiträgen. 1946 besassen drei Viertel der Krankenversicherten eine solche Zusatzversicherung. Das war weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Die Vorlage ging von der Überlegung aus, dass Infizierte, die sich eine Kur nicht leisten konnten, eine Gefahr für die Gesundheit Dritter darstellten. Das vorgeschlagene Versicherungsobligatorium hätte also vor allem der Prophylaxe gedient.
Im Abstimmungskampf blieb die Frage strittig, ob der Bund mit dem ergänzten Tuberkulosegesetz gleichsam durch die Hintertür ein Krankenversicherungsobligatorium einführen solle. Die mit 75 Prozent Nein-Stimmen deutliche Ablehnung der Vorlage wurde von Bundesrat und Verwaltung als Votum gegen ein solches Obligatorium interpretiert.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin (2009), Das verpasste Jahrzehnt. Krankenversicherung und Gesundheitspolitik (1938–1949), in M. Leimgruber, M. Lengwiler (ed.), Umbruch an der ‹inneren Front›. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz 1938–1948, 165–184, Zürich; Gredig Daniel (2002), Von der „Gehilfin“ des Arztes zur professionellen Sozialarbeiterin. Professionalisierung in der sozialen Arbeit und die Bedeutung der Sozialversicherungen am Beispiel der Tuberkulosenfürsorge Basel (1911–1961), in: H.-J. Gilomen, S. Guex, B. Studer (ed.), Von der Barmherzigkeit zur Sozialversicherung. Umbrüche und Kontinuitäten vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, 221–241, Zürich; Immergut Ellen M. (1992), Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe, Cambridge; HLS / DHS / DSS: Tuberkulose.
(12/2014)
Der Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit wäre nicht möglich gewesen ohne die massive Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte. 1950 zählte man in der Schweiz 285.000, zwanzig Jahre später 1.080.000 ausländische Staatsangehörige (6.1 respektive 17.2 Prozent der Wohnbevölkerung). Ein grosser Teil der Ausländerinnen und Ausländer stammte zunächst aus Italien, später auch aus andern südeuropäischen Ländern (Spanien, Portugal, Jugoslawien). Aufenthaltsbewilligungen waren meist befristet, so dass der Grossteil der Arbeiterinnen und Arbeiter die Schweiz nach weniger als einem Jahr vorübergehend verlassen musste (Rotationsprinzip). Erst Mitte der 1960er-Jahre wurden die dauerhafte Niederlassung und der Familiennachzug teilweise erleichtert. Vor dem Hintergrund eines zunehmend ausländerfeindlichen Klimas (Schwarzenbach-Initiative gegen die "Überfremdung") verschärfte sich die Migrationspolitik allerdings. Der Bund ergriff nun Massnahmen zur zahlenmässigen Stabilisierung der ausländischen Wohnbevölkerung, etwa mittels Vorschreibens von Höchstzahlen und Kontingenten für einzelne Unternehmen und Länder.
Die Rekrutierung von Arbeitskräften aus dem Ausland betraf auch die Sozialversicherungen. Bereits 1929 war die Schweiz einem Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) beigetreten, das Diskriminierungen in der Unfallfallversicherung verhindern sollte. Von Beginn an finanzierten die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter die AHV mit, ohne später notwendigerweise auch Leistungen beziehen zu können. Die Schweiz schloss zudem mit zahlreichen Staaten Sozialversicherungsabkommen ab, die insbesondere den Bezug von Leistungen im Ausland regelten. Die Abkommen mit Italien von 1949, 1951 und 1962 erleichterten beispielsweise den Transfer von AHV- und IV-Renten nach Italien und sahen die obligatorische Versicherung italienischer Arbeitskräfte gegen Krankheit vor. Diskriminierungen, die vor allem die zahlreichen Saison- und Kurzaufenthalter betrafen, bestanden indes weiterhin und verstärkt in den freiwilligen Versicherungszweigen. So waren Saisonniers nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert und verfügten über keine berufliche Vorsorge.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Arlettaz Gérald, Arlettaz Silvia (2006), L’Etat social national et le problème de l’intégration des étrangers 1890 – 1925, Studien und Quellen, 31, 191–217; Gees Thomas (2006), Die Schweiz im Europäisierungsprozess. Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzepte am Beispiel der Arbeitsmigrations-, Agrar- und Wissenschaftspolitik, Zürich; Mahnig Hans (ed.), Histoire de la politique de migration, d’asile et d’integration en Suisse depuis 1948, Zürich; HLS / DHS / DSS: Ausländer.
(12/2014)
1952 stimmten die Schweizer Delegierten an der 35. Internationalen Arbeitskonferenz in Genf dem Übereinkommen 102 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit zu. Die Internationale Arbeitskonferenz war das Hauptorgan der 1919 gegründeten Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Nach der Auflösung des Völkerbundes wurde die IAO 1945 zu einer Spezialorganisation der Vereinten Nationen (UNO). Beibehalten wurde die drittelsparitätische Besetzung der nationalen Delegationen (Regierungs-, Arbeitnehmer-, und Arbeitgebervertreter) für die regelmässig stattfindenden Konferenzen. Obwohl sie der UNO nicht beitrat, blieb die Schweiz 1945 Mitglied der IAO.
Die IAO war vom Gedanken getragen, dass die Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Staat eine wichtige Voraussetzung für eine dauerhafte Friedensordnung sei. Sie setzte sich deshalb für eine Harmonisierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten ein. 1948 begannen die Arbeiten für die Festlegung von Mindeststandards der Sozialen Sicherheit. Das Übereinkommen 102 wurde im Juni 1952 verabschiedet. Es sah Normen für neun Bereiche vor (zum Beispiel medizinische Versorgung, Alter, Invalidität, Mutterschutz), deren Einhaltung anhand statistischer Kriterien geprüft wurde (etwa bezüglich der Zahl der Leistungsberechtigten und der Höhe der Leistungen).
Die Delegierten des Bundes stimmten dem Abkommen usanzgemäss zu. Die Ratifizierung erwies sich für die Schweiz allerdings als problematisch. Wie der Bundesrat festhielt, erfüllte sie die Auflagen lediglich im Bereich der Unfallversicherung. Insbesondere fehlte eine Invalidenversicherung, und die AHV-Renten waren zu tief angesetzt. Daraus dürfe, so der Bundesrat, indes nicht geschlossen werden, der "soziale Schutz" in der Schweiz sei ungenügend. Vielmehr gehe das "neue internationale Instrument" an den "spezifisch schweizerischen Verhältnissen" vorbei. Erst 1977 ratifizierte die Schweiz schliesslich die ersten Teile des Übereinkommens 102, allerdings mit Ausnahme des Teils zum Krankentaggeld, das das schweizerische Sozialversicherungsrecht bis heute nicht kennt. Das heisst, nachdem die IV geschaffen (1960) und die Altersvorsorge auf eine neue Grundlage gestellt (1972) worden waren und sich Familienzulagen auf kantonaler Ebene durchgesetzt hatten.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Kott Sandrine, Droux Joëlle (2013), Globalizing social rights. The International Labour Organization and beyond, Basingstoke; Kneubühler Helen Ursula (1982), Die Schweiz als Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, Bern; HLS / DHS / DSS: Internationale Arbeitsorganisation ILO.
(12/2014)
Die Rentenreform von 1957 wurde von Bundeskanzler Adenauer persönlich lanciert. Gemäss den offiziellen Verlautbarungen sollte sie einen neuen "Generationenvertrag" begründen und zu einem Integrationsfaktor für die junge Republik werden. Zudem hatte sie die Probleme zu lösen, die sich bei der Überführung der Sozialversicherungen in die Nachkriegsordnung stellten.
Trotz verschiedener Anläufe für eine umfassende Grundsicherung im Sinn des Beveridge-Plans war das nach Versichertenklassen "gegliederte System" der Bismarck'schen Sozialversicherung nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten worden. Nach der Währungsreform von 1948 wurde es punktuell den neuen Rahmenbedingungen angepasst, indem etwa Elemente der Selbstverwaltung wiederhergestellt und Rentenzuschläge ausgerichtet wurden. Bald konnten jedoch die Alters-, Witwen- und Waisenrenten nicht mehr mit der Lohnentwicklung der Nachkriegskonjunktur mithalten. Eine Untersuchung zeigte 1955 auf, dass die Renten nur mehr 30 Prozent eines Durchschnittslohns abdeckten und viele Rentnerinnen und Rentner am Rande des Existenzminimums lebten.
Adenauer drückte die Rentenreform gegen die Opposition seiner Finanz- und Wirtschaftsminister durch, die insbesondere eine Zunahme der Inflation befürchteten. Die Reform beinhaltete einerseits einen Wechsel vom Kapitalbildungs- zum Umlageprinzip, nach dem seit 1947 auch die schweizerische AHV funktionierte. Demnach bestritt die Sozialversicherung die Renten, die nach Höhe der von den Bezügern einbezahlten Beiträge abgestuft waren, nicht mit dem angesparten Kapital, sondern aus den laufenden Einnahmen. Andererseits sah die Reform "dynamische Renten" vor, welche laufend an die allgemeine Lohn- und Preisentwicklung angepasst werden sollten. Für die deutschen Rentnerinnen und Rentner bedeutete dies eine sofortige Rentenerhöhung von 60 bis 70 Prozent. Auch sie konnten nun am "Wirtschaftswunder" teilhaben.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Schulz Günther (ed.) (2005), 1949–1957: Bundesrepublik Deutschland. Bewältigung der Kriegsfolgen, Rückkehr zur sozialpolitischen Normalität (Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Band 3), Baden-Baden; Metzler Gabriele (2003): Der deutsche Sozialstaat. Vom bismarckschen Erfolgsmodell zum Pflegefall, Stuttgart; Stolleis Michael (2003), Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, Stuttgart.
(12/2014)
Im Juni 1959 verabschiedete das Parlament das Invalidenversicherungsgesetz (IVG). Bis dahin war nur ein Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Unfallversicherung, Pensionskassen oder kantonale Versicherungen gegen die Folgen von Invalidität versichert. 1925 war die Einrichtung einer Invalidenversicherung zu Gunsten der (vermeintlich) raschen Realisierung der AHV aufgeschoben worden. Der Bund richtete in der Folge nur bescheidene Beiträge an Einrichtungen für Behinderte und Hilfsorganisationen wie die Pro Infirmis aus. Viele Menschen mit Behinderungen waren deshalb auf Sozialhilfe oder private Unterstützung angewiesen. Die Invalidenversicherung kam zu Beginn der 1950er-Jahre wieder auf die politische Agenda. Auch zahlreiche Vorstösse im Parlament und zwei Volksinitiativen der Partei der Arbeit und der Sozialdemokratischen Partei verlangten ihre Einführung. 1955 setzte der Bundesrat eine Expertenkommission ein, im Herbst 1958 veröffentlichte er einen Gesetzesentwurf. Die Verabschiedung im Parlament erfolgte ebenfalls speditiv, so dass das IVG ohne Referendum am 1. Januar 1960 in Kraft treten konnte.
Die Ausgestaltung der IV war weitgehend durch die AHV vorgespurt. Beitrags-, Renten- und Finanzierungssystem wurden übernommen. Die ersten IV-Renten waren somit keineswegs existenzsichernd. Von Beginn an stellte das IVG das Prinzip "Eingliederung vor Rente" ins Zentrum: Es sah neben Geldleistungen medizinische und berufliche Massnahmen, wie Berufsberatung oder Stellenvermittlung, ferner Massnahmen für die Sonderschulung sowie die Abgabe von Hilfsmitteln wie Rollstühle oder Hörhilfen vor. Im Gegensatz zur britischen und deutschen Gesetzgebung verzichtete das IVG darauf, den Unternehmen Quoten für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen vorzuschreiben; der anhaltende Arbeitskräftemangel würde, so die verbreitete Erwartung Ende der 1950er-Jahre, genügend Anreize schaffen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Germann Urs (2008), Eingliederung vor Rente. Behindertenpolitische Weichenstellungen und die Einführung der schweizerischen Invalidenversicherung, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 58, 178–197; Lengwiler Martin (2007a), Im Schatten der Arbeitslosen- und Altersversicherung. Systeme der staatlichen Invaliditätsversicherung nach 1945 im europaïschen Vergleich, Archiv für Sozialgeschichte, 47, 325–348.
(12/2014)
Ab 1960 nahm der Anteil der fürsorgeabhängigen Frauen und Männer deutlich ab. Dies war eine Folge der Einführung der AHV (1948) und der IV (1960), vor allem aber der Vollbeschäftigung und des Lohnwachstums in der Zeit des Nachkriegsbooms. Vor allem die städtischen Fürsorgeämter wurden dadurch merklich entlastet. Zugleich sahen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vermehrt mit schwierigen sozialen Situationen konfrontiert. Armut in der Wohlstandsgesellschaft wurde dabei oft als Folge individueller Anpassungsschwierigkeiten interpretiert.
Bis Mitte der 1970er-Jahre revidierten die meisten Kantone ihre Armengesetze, die teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammten. Ansatzweise widerspiegelten die neuen Erlasse die Methode des Social Casework, die in den USA entwickelt worden war. Demnach sollten Einzelfallabklärungen, das Erstellen individueller Hilfspläne und die Förderung der Selbständigkeit an die Stelle von Kontrolle und Disziplinierung treten. So war denn nun von "Klienten" und "Beratung" die Rede. Parallel dazu ging die Zahl der Versorgungen in Arbeitsanstalten stark zurück, und die Unterstützung durch Bargeld löste die Abgabe von Naturalien ab. Die Hilfeleistungen sollten nun das soziale Existenzminimum garantieren, das auch Auslagen für kulturelle Aktivitäten und ein bescheidenes Taschengeld beinhaltete.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Matter Sonja (2011), Der Armut auf den Leib rücken: Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900–1960), Zürich; Tabin Jean-Pierre et al. (2010 [2008]), Temps d’assistance. L’assistance publique en Suisse romande de la fin du XIXe siècle à nos jours, Lausanne; Sutter Gaby (2007), Vom Polizisten zum Fürsorger: Etablierung und Entwicklung der professionellen Fürsorge in der Gemeinde Bern 1915–1961, Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 69, 259–287; HLS / DHS / DSS: Fürsorge.
(12/2014)
Reformen in der Krankenversicherung waren seit der Einführung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes von 1911 (KUVG) langwierig und kompliziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der krankenversicherten Personen stetig an. Lag der Anteil der Versicherten 1945 bei 48 Prozent der Bevölkerung, nahm er - nicht zuletzt dank den kantonalen Versicherungsobligatorien - bis 1970 auf 89 Prozent zu. Die Ablehnung des Tuberkulosegesetzes von 1949 wurde von Bundesrat und Verwaltung als Veto gegen ein Versicherungsobligatorium gewertet. Die Mitte der 1950er-Jahre aufgenommenen und wiederholt verzögerten Arbeiten für eine Teilrevision des KUVG beschränkten sich deshalb auf punktuelle Reformen, die die Grundzüge des bald fünfzigjährigen Regelwerks nicht in Frage stellten.
Die Revision von 1964, die ohne Referendum zustande kam, erleichterte den Versicherungsbeitritt, erweiterte die Leistungen und erhöhte die Subventionen an die Krankenkassen. Auch wenn sie keine substantielle Reform beinhaltete, war der Revision dennoch ein jahrelanges Seilziehen zwischen den involvierten Parteien vorausgegangen. Angesichts des medizinischen Fortschritts und des expandierenden Gesundheitsmarkts geriet die Krankenversicherung immer mehr zum Spielball gut organisierter und referendumsmächtiger Interessensgruppen, insbesondere der Krankenkassen, der Ärzte und der chemischen Industrie, aber auch von neuen Gesundheitsberufen wie den Chiropraktikern. Bei der Revision von 1964 gelang es vor allem den Ärzten, für sie günstige Bedingungen auszuhandeln, etwa bezüglich der Honorarabstufung nach dem Einkommen der Patientinnen und Patienten und der Honorarabrechnung.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Alber Jens, Bernardi-Schenkluhn Brigitte (1992), Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Frankfurt; Sommer Jürg (1978), Das Ringen um die soziale Sicherheit in der Schweiz. Eine politisch-ökonomische Analyse der Ursprünge, Entwicklungen und Perspektiven sozialer Sicherung im Widerstreit zwischen Gruppeninteressen und volkswirtschaftlicher Tragbarkeit, Diessenhofen; HLS / DHS / DSS: Krankenversicherung.
(12/2014)
Mitte der 1960er-Jahre lebten in der Schweiz schätzungsweise 200.000 AHV- und IV-Rentnerinnen und Rentner unter dem Existenzminimum. Sie besassen keine berufliche Vorsorge und kein eigenes Vermögen und waren von der Fürsorge oder von Familienangehörigen abhängig. Das Ziel der am 19. März 1965 vom Parlament beschlossenen Einführung von Ergänzungsleistungen (EL) war, ihnen ein regelmässiges Mindesteinkommen zu sichern. Rentenzuschüsse sollten die Differenz zwischen einer festgelegten Einkommensuntergrenze (zum Beispiel für Alleinstehende: 3000 Franken im Jahr) und dem effektiven (Renten-)Einkommen ausgleichen. Im Gegensatz zur Fürsorge bestand für Ergänzungsleistungen von Beginn an ein Rechtsanspruch. Allerdings blieb es den Kantonen überlassen, ob sie das System der Ergänzungsleistungen einführen und zur teilweisen Deckung ihrer Ausgaben Subventionen des Bundes in Anspruch nehmen wollten. Finanziert wurden die EL nicht über Lohnprozehnte, sondern ausschliesslich über Beiträge von Bund und Kantonen.
Die EL waren ein Anhängsel der 6. AHV-Reform (1964), die eine - grösstenteils teuerungsbedingte - Rentenerhöhung von 30 Prozent gebracht hatte. Im Vorfeld waren Forderungen nach existenzsichernden Renten im Raum gestanden, denen 1962 zwei Volksinitiativen der Zeitschrift "Beobachter" und linker Kreise Nachdruck verliehen. Unterstützt durch Arbeitgeber- und Versicherungsvertreter, hielten Bundesrat und Parlament schliesslich dafür, dass die AHV den "Charakter einer Basisversicherung" behalten und eine Erweiterung des Sozialwerks die berufliche und private Vorsorge nicht beeinträchtigen solle. Im Grundzug nahmen sie damit die spätere Drei-Säulen-Doktrin vorweg. Als Ausgleich für das Tiefhalten der AHV-Renten (und Beiträge) habe aber, so der Bundesrat, neben die Volksversicherung "ein System von besonders ausgestalteten Bedarfsleistungen zu treten, die dem sozial schwächsten Teil der Bevölkerung eine minimale Existenz garantieren". Zunächst als Übergangslösung gedacht, entwickelten sich die EL über die Jahrzehnte hinweg zu einem ständigen Leistungsbereich. Immer wichtiger geworden ist vor allem ihre Funktion, die steigenden Kosten für die Pflege im Alter zu decken.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; HLS / DHS / DSS: Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV.
(12/2015)
Am 3. Dezember 1972 nahmen die Stimmberechtigten eine wichtige Weichenstellung in der Altersvorsorge vor. Mit 75 Prozent Ja-Stimmen beschlossen sie die Verankerung der Drei-Säulen-Doktrin in der Bundesverfassung und eine obligatorische Berufsvorsorge. Gleichzeitig erteilten sie der Volksinitiative der Partei der Arbeit (PdA) "für eine Volkspension" eine Abfuhr. Die PdA-Initiative wollte die AHV stärken. Die staatliche Volkspension sollte künftig mindestens 60 Prozent des Einkommens abdecken, auf jeden Fall aber eine jährliche Rente von 6000 Franken garantieren. Die minimale AHV-Rente für Alleinstehende betrug damals 2640 Franken, der durchschnittliche Arbeiterlohn etwa 23'000 Franken pro Jahr. Faktisch hätte dies das Ende der öffentlichen und privaten Versicherungs- und Pensionskassen bedeutet. Diese sollten nach der Initiative in das neue Versicherungssystem "eingebaut" werden. Demgegenüber propagierte der Gegenvorschlag, hinter dem nicht nur die bürgerlichen Parteien, Wirtschaftsverbände und Privatversicherer, sondern auch die Sozialdemokratische Partei (SPS) und die Gewerkschaften standen, eine Kombination aus einer existenzsichernden AHV (1. Säule), einem Pensionskassenobligatorium (2. Säule) und der freiwilligen Selbstvorsorge (3. Säule). Schmackhaft gemacht wurde diese Vorlage zusätzlich durch die Ankündigung der 8. AHV-Revision, welche die bestehenden Renten auf einen Schlag verdoppeln sollte.
Mit ihrem Votum verhalfen die Stimmberechtigten einer "schweizerischen Lösung" der Altersvorsorge zum Durchbruch. Diese Lösung beruhte auf einer minimalen staatlichen Altersvorsorge und räumte der privaten Vorsorge grossen Raum ein. Vor dem Hintergrund der starken Zunahme der beruflich Versicherten (1941 waren es 15 Prozent, 1966 bereits 45 Prozent der Beschäftigten) hatte der Bundesrat 1963, unter Berufung auf ein Konzept der Privatversicherer, erstmals von "drei Arten" der Sicherung gesprochen. Erst unter dem Druck der PdA-Initiative und eines gleichzeitig eingereichten (und später zurückgezogenen) Volksbegehrens der SPS fand sich jedoch eine Mehrheit, die auch für die zweite Säule ein Obligatorium befürwortete.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Lengwiler Martin (2003), Das Drei-Säulen-Konzept und seine Grenzen: private und berufliche Altersvorsorge in der Schweiz im 20. Jahrhundert, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 48, 29–47.
(12/2014)
In den 1970er-Jahren kam die Krankenversicherung erneut auf die politische Agenda. Einmal mehr stand ein allgemeines Versicherungsobligatorium zur Debatte. Nach der Ablehnung des Tuberkulosegesetzes (1949) war diese Frage in den Hintergrund geraten. Die erste Teilrevision des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes von 1964 hatte sich auf punktuelle Anpassungen beschränkt. Angesichts der rasant ansteigenden Kosten im Gesundheitswesen setzte Ende der 1960er-Jahre eine Reformdebatte ein. Wie bereits 1964 beteiligten sich daran nicht nur die politischen Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Vor allem die Krankenkassen, die Ärzteschaft und die Pharmaindustrie machten dem Parlament, Bundesrat und Bundesamt für Sozialversicherung die Meinungsführerschaft strittig. Im Kern drehte sich die vertrackte Diskussion um zwei Grundsatzfragen: Sollte die Schweiz wie andere Länder und von der Linken seit langem gefordert die Kranken- und Unfallversicherung obligatorisch erklären? Und: Wie sollten die Leistungen künftig finanziert werden? Diesbezüglich stand neu die Option einer Finanzierung über Lohnprozente im Raum.
Am 8. Dezember 1974 standen die Stimmberechtigten vor der Wahl zwischen drei Varianten: Eine Volksinitiative der Sozialdemokratischen Partei verlangte ein umfassendes Versicherungsobligatorium (Krankenpflege, Mutterschaft, Unfallversicherung), das unter anderem über Lohnprozehnte finanziert werden sollte. Der Gegenvorschlag des Parlaments, hinter dem die bürgerlichen Parteien, Verbände, Krankenkassen und Ärzte standen, verzichtete demgegenüber auf das Versicherungsobligatorium bei den ambulanten Behandlungen. Er sah hingegen eine obligatorische Versicherung für stationäre Behandlungen vor, die über Lohnabzüge finanziert werden sollte. In Anlehnung an einen Sitzungsort bezeichnete ein 1972 erstellter Expertenbericht diese obligatorische Spitalversicherung als „Flimser Modell“. Die Stimmberechtigten hatten schliesslich eine dritte Möglichkeit: Sie konnten beide Vorlagen ablehnen und sich für den Status quo entscheiden. Die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern entschied sich nach einem engagierten Abstimmungskampf für ein doppeltes Nein und favorisierte damit den Status quo. Damit war - nach 1900 und 1949 - ein weiterer Anlauf für eine (teilweise) obligatorische Krankenversicherung gescheitert. Zählt man die Ja-Stimmen für beide Vorlagen zusammen, hatte sich indes sehr wohl eine Mehrheit für eine Neuausrichtung der Krankenversicherung ausgesprochen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Alber Jens, Bernardi-Schenkluhn Brigitte (1992), Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Frankfurt; Sommer Jürg (1978), Das Ringen um die soziale Sicherheit in der Schweiz. Eine politisch-ökonomische Analyse der Ursprünge, Entwicklungen und Perspektiven sozialer Sicherung im Widerstreit zwischen Gruppeninteressen und volkswirtschaftlicher Tragbarkeit, Diessenhofen; HLS / DHS / DSS: Krankenversischerung.
(12/2016)
1974/75 schlitterte die Schweiz in eine zweijährige Rezession, die sozialpolitische Interventionen nötig machte, aber auch den weiteren Ausbau der Sozialen Sicherheit grundsätzlich in Frage stellte. Am Anfang der Rezession Mitte der 1970er-Jahre standen der Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods (März 1973) und die Erdölkrise (Herbst 1973). Bis 1977 ging das Bruttosozialprodukt um fünf bis sieben Prozent zurück. Die Folgen waren Einkommenseinbussen und zunehmend unsichere Arbeitsverhältnisse. Die geringe Verbreitung der Arbeitslosenversicherung und die Rückwanderung ausländischer Arbeitskräfte erlaubten es jedoch, die offiziellen Arbeitslosenzahlen trotz Arbeitsplatzverlusten tief zu halten. Die Verteilungs- und Arbeitskämpfe verschärften sich. Auf der einen Seite verlangten linke Parteien und Gewerkschaften eine antizyklische Konjunkturpolitik. Auf der bürgerlichen Seite erhielten Forderungen nach einer "Gesundschrumpfung" der Wirtschaft, nach Steuersenkungen und Deregulierung Auftrieb.
Das Ende der Boomjahre wirkte sich auch auf die Soziale Sicherheit aus. Bei der Neuordnung der Arbeitslosenversicherung von 1976 handelte es sich um eine Massnahme, die unmittelbar durch den Beschäftigungseinbruch nötig wurde. Bei der IV stiegen die Kosten, während die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt gleichzeitig die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen erschwerte. 1976 setzte das Eidgenössische Departement des Innern eine Arbeitsgruppe für die Überprüfung der Organisation der IV ein, die zwar Vorschläge für administrative Verbesserungen machte, jedoch keine Lösung für den langfristigen Kostenanstieg fand. Deutlich zeigte sich die veränderte Ausgangslage auch bei der AHV. War die 8. AHV-Revision (1972) noch ganz im Zeichen des Ausbaus des Sozialwerks gestanden, wies das Parlament 1974 eine automatische Anpassung der Renten an die Preis- und Lohnentwicklung - und damit erstmals überhaupt eine AHV-Vorlage - an den Bundesrat zurück. Sie sollte erst 1979 eingeführt werden. Stattdessen beschloss es verschiedene Spar- und Sofortmassnahmen, die den Bundeshaushalt kurzfristig entlasten sollten. Dabei rückten Fragen nach der grundsätzlichen Tragbarkeit der Sozialen Sicherheit und der langfristigen Konsolidierung der Sozialwerke ins Zentrum der politischen Debatte.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Tabin Jean-Pierre, Togni Carola (2013), L’assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924-1982), Lausanne; Müller Margrit, Woitek Ulrich (2012), Wohlstand, Wachstum und Konjunktur, in P. Halbeisen, M. Müller, B. Veyrasset (ed.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 91–222, Basel; Ischer Philipp (2006), Ausbau oder Konsolidierung? Der politische Diskurs der 1970er Jahre in der Schweiz im Bereich der AHV, Studien und Quellen, 31, 141–166.
(12/2014)
Am 7. Dezember 1975 nutzten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Gelegenheit, einen "alten Zopf" abzuschneiden. Mit 76 Prozent Ja-Stimmen stimmten sie dem Wechsel zum Wohnsitzprinzip in der Sozialfürsorge zu: Damit bekamen unterstützungsbedürftige Schweizerinnen und Schweizer in den Genuss der vollen Niederlassungsfreiheit.
Die Bundesverfassung von 1874 garantierte zwar grundsätzlich die Niederlassungsfreiheit. Sie machte jedoch eine Ausnahme bei Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die unterstützungsbedürftig waren. War der Heimatkanton nicht bereit, für die Unterstützung aufzukommen, konnte der Wohnkanton den Betroffenen die Niederlassung entziehen und die Heimschaffung anordnen. Kantonsverweisungen waren ebenfalls zulässig aus polizeilichen Gründen, namentlich bei vorbestraften Personen.
Bereits 1916 hatten einzelne Kantone auf den Konkordatsweg versucht, solche Massnahmen zu beschränken. Noch in den 1960er-Jahren kam es aber zu Heimschaffungen und zur Bestrafung wegen Nichtbeachtens solcher Verweisungen. Erst 1964 waren alle Kantone dem Konkordat über die wohnörtliche Unterstützung beigetreten. Die Neuregelung von 1975, die zwei Jahre später auf Gesetzesstufe verankert wurde, sah schliesslich generell die wohnörtliche Unterstützungspflicht vor. Das Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger von 1977 markiert deshalb einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte des schweizerischen Armen- und Fürsorgewesens, in dem das Prinzip der heimatörtlichen Unterstützung immer eine wichtige Rolle gespielt hatte. Auch nach dem neuen Gesetz konnten Wohnkantone allerdings die Kosten für die gewährte Unterstützung während einer Frist von zehn Jahren von den Heimatkantonen zurückfordern. 1990 wurde diese Rückerstattungspflicht auf zwei Jahre verkürzt. 2013 wurde ihre gänzliche Abschaffung beschlossen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Matter Sonja (2011), Das Wohnort- und Heimatortprinzip in der Fürsorge vor 1975, in J. Mooser, S. Wenger (ed.), Armut und Fürsorge in Basel, 239–248, Basel; Kreis Georg (2011), 1975 – Das endliche Ende der Heimschaffungen in der Fürsorge, in J. Mooser, S. Wenger (ed.), Armut und Fürsorge in Basel, 249–259, Basel. HLS / DHS / DSS: Fürsorge; Volksabstimmungen.
(12/2014)
Im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten kannte die Schweiz bis in die 1970er-Jahre keine obligatorische Arbeitslosenversicherung. Dieser Schritt erfolgte erst 1976. Das Bundesgesetz von 1951 hatte die 1924 eingeführte Subventionslösung beibehalten. In den Boomjahren war der Anteil der freiwillig Versicherten sogar rückläufig. 1974 betrug er weniger als ein Fünftel der Erwerbstätigen. Erst unter dem Eindruck der Rezession kam es zu einer grundlegenden Neuregelung, die - gemessen an anderen sozialpolitischen Reformvorhaben - erstaunlich rasch realisiert wurde.
Allein 1975/76 gingen in der Schweiz 300.000 Stellen verloren, wovon allerdings zwei Drittel durch die Rückwanderung ausländischer Arbeitskräfte aufgewogen wurden, weil die Behörden ihre Aufenthaltsbewilligungen nicht erneuerten. Besonders stark von Kündigungen betroffen waren auch Schweizerinnen. Die geringe Verbreitung der Arbeitslosenversicherung und die Rückwanderung ausländischer Arbeitskräfte erlaubten es jedoch, die offiziellen Arbeitslosenzahlen tief zu halten. Am 13. Juni 1976 nahmen die Stimmberechtigten einen neuen Verfassungsartikel an, der die Leitplanken für die künftige Arbeitslosenversicherung setzte: ein Versicherungsobligatorium für Unselbständigerwerbende, eine Finanzierung durch Lohnabzüge und eine dezentrale Verwaltung. Nur wenige Monate später erliess der Bundesrat eine Übergangsordnung, die bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes gelten sollte. Die Betroffenen erhielten das Anrecht auf 150 Taggelder, die so bemessen sein sollten, dass sie 70-80 Prozent des Lohnausfalls abdeckten. Das Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung wurde 1982 verabschiedet und trat am 1. Januar 1984 in Kraft. Die gesetzliche Regelung erhöhte die Anzahl Taggelder auf 180. Ebenfalls vorgesehen waren Kurzarbeits-, Schlechtwetter- und Insolvenzentschädigungen, Massnahmen zur Arbeitsmarktintegration sowie Kontrollmassnahmen gegen Versicherungsmissbrauch.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Togni Carola (2013), Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse, Thèse de doctorat, Université de Berne; Tabin Jean-Pierre, Togni Carola (2013), L’assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924–1982), Lausanne; Schmidt Manfred G. (1985), Der schweizerische Weg zur Vollbeschäftigung: eine Bilanz der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt am Main; HLS / DHS / DSS: Arbeitslosenversicherung ALV.
(12/2014)
Inflationsraten von bis zu zehn Prozent führten während des Booms der 1960er- und 70er-Jahre zur laufenden Entwertung der AHV- und IV-Renten. Gemäss dem 1972 revidierten Vorsorgeartikel (BV Art. 34quater) waren die Renten deshalb regelmässig an die Teuerung anzupassen. Nur so war es möglich, existenzsichernde Renten auszurichten, wie dies die Bundesverfassung postulierte. Bis 1972 hatten Rentenanpassungen jeweils einen Parlamentsbeschluss bedingt. Mit der 9. AHV-Revision erhielt der Bundesrat die Befugnis, solche Anpassungen selbständig alle zwei Jahre vorzunehmen, wobei diese Frist je nach wirtschaftlicher Lage verkürzt oder verlängert werden konnte.
Im Vorfeld der 9. AHV-Revision standen verschiedene Berechnungsmodi zur Diskussion. Nach 1974 geriet die Frage der Rentenanpassung in den Strudel der Auseinandersetzungen um die Konsolidierung der AHV. Ein erster Entwurf (1973) erlaubte dem Bundesrat, die Renten je nach Konjunkturlage flexibel an die Teuerungs- oder die Lohnentwicklung anzupassen. Diese rentnerfreundliche Methode wurde damals als "Volldynamisierung" bezeichnet. Der Anpassungsmechanismus, der 1979 gesetzlich verankert wurde, folgte dann allerdings der konservativeren Methode der "prozentualen Dynamisierung". Massgebend war - und blieb bis heute - ein Mischindex, der dem Mittelwert aus dem Lohnindex des damaligen Bundesamts für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA, heute: Staatssekretariat für Wirtschaft Seco) und dem Landesindex der Konsumentenpreise entspricht. Lohn- und Preisentwicklung werden so gleichermassen berücksichtigt.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Ischer Philipp (2006), Ausbau oder Konsolidierung? Der politische Diskurs der 1970er Jahre in der Schweiz im Bereich der AHV, Studien und Quellen, 31, 141–166; HLS / DHS / DSS: Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV.
(12/2014)
Das Unfallversicherungsgesetz (UVG) sah eine obligatorische Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor, die mindestens 12 Stunden pro Woche arbeiten. Gemäss dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz von 1911 war das Versicherungsobligatorium auf wichtige Branchen, insbesondere auf die Industrie, beschränkt. 1974 lehnte der Souverän eine obligatorische Unfallversicherung zusammen mit zwei Krankenkassenvorlagen ab. Mitte der 1970er-Jahre waren etwa zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Suva versichert. Kantonale Vorschriften und Gesamtarbeitsverträge unterstellten weitere Erwerbstätige der Versicherungspflicht, hinzu kamen Unfallversicherungen auf betrieblicher und freiwilliger Basis. Insgesamt dürften zu dieser Zeit rund 95 Prozent der Erwerbstätigen gegen die Folgen von Unfällen versichert gewesen sein. Je nach Police unterschieden sich jedoch die Leistungen, die die Versicherten erwarten durften. Nicht erwerbstätige Personen können sich fakultativ bei einer Krankenkasse versichern, die jedoch eine geringere Deckung bietet. Die Erwerbstätigen werden dadurch gegenüber Personen ohne Arbeit, insbesondere Personen mit Familienverpflichtungen, bevorzugt.
Der Bereich der freiwilligen Versicherung, der auch Selbständige umfasste, gehörte seit jeher zur Domäne der privaten Versicherungsgesellschaften. Das neue UVG von 1984 sah vor, dass private Versicherer weiterhin - und neu auch Krankenkassen - im Unfallversicherungsgeschäft tätig sein konnten. Ausgenommen waren lediglich Branchen mit hohen Berufsrisiken, die von Gesetzes wegen bei der Suva versichert blieben. Die privaten Versicherer hatten allerdings die gleichen Leistungen wie die Suva zu erbringen. Ebenfalls einheitlich geregelt wurde die Rechtspflege.
Für die Suva bedeutete die beschränkte Öffnung des Versicherungsmarkts, dass sie sich einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sah. Umso mehr als aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels die Zahl der Beschäftigten aus der Industrie, die zwingend bei der Suva versichert waren, zurückging. Die Suva gab sich 1985 deshalb ein neues Leitbild, welches das Bemühen um Kundenorientierung und die Notwendigkeit neuer "Marktdurchdringungsstrategien" unterstrich.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Lengwiler Martin (2006), Risikopolitik im Sozialstaat: Die schweizerische Unfallversicherung (1870–1970), Köln; Schweizerische Unfallversicherungsgesellschaft (1993), 75 Jahre SUVA. Das Menschenmögliche, Luzern. HLS / DHS / DSS: Unfallversicherung; Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA.
(12/2014)
Ziel der beruflichen Vorsorge ist es, die "gewohnte Lebenshaltung" sicherzustellen. So lautete jedenfalls das Leistungsversprechen, das 1972 mit dem Obligatorium in der beruflichen Vorsorge Eingang in die Bundesverfassung gefunden hatte. Dagegen sollte die AHV gemäss dem Drei-Säulen-Prinzip auf die Sicherung des Existenzbedarfs beschränkt bleiben.
Parlament und Bundesrat sahen zunächst vor, 1974 ein Gesetz über die Berufsvorsorge zu verabschieden. Erst 1985 trat das Gesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) dann aber in Kraft. Bedingt durch die Rezessionen Mitte der 1970er-und zu Beginn der 1980er-Jahre sowie das Erstarken der neokonservativen Kritik an der staatlichen Daseinsvorsorge fiel die Lösung deutlich "schlanker" aus als angekündigt: Im Gegensatz zur AHV beruht das BVG auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Die Finanzierung erfolgt aber ebenfalls durch paritätisch verteilte Lohnprozente. Die bestehenden Pensionskassen wurden beibehalten, jedoch gesetzlichen Regulierungen unterworfen. Nicht durchsetzen konnte sich im Gesetzgebungsverfahren das für die Versicherten günstigere Leistungsprimat, bei dem sich die Rente am versicherten Lohn (und nicht an den effektiven Beiträgen) orientiert. Den sozialpolitischen Restriktionen ebenfalls zum Opfer fiel die laufende Anpassung der Renten an die Preis- und Lohnentwicklung. Zudem nahm das BVG Arbeitslose, Teilzeitarbeitende - zu einem grossen Teil Frauen - und Geringverdienende von der Versicherungspflicht aus. Ohne grosse Abstriche wurde dagegen die Möglichkeit zur Vorsorge mittels steuerbefreiten Vorsorgekonti und -versicherungen realisiert (3a-Säule).
In Erwartung der neuen Regelung war der Anteil der beruflich versicherten Erwerbstätigen bereits vor Inkrafttreten des BVG deutlich angestiegen. Er betrug 1984 62 Prozent der Erwerbstätigen. Deutlich nahmen ebenfalls die von den Pensionskassen verwalteten Vermögen zu: Betrugen diese 1970 noch 37 Mrd. Franken (41 Prozent des Bruttosozialprodukts), waren es 1987 bereits 167 Mrd. Franken (74 Prozent). 2011 verwalteten die Pensionskassen Vermögenswerte im Umfang von 620 Mrd. Franken.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu (2008), Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge; Lengwiler Martin (2003), Das Drei-Säulen-Konzept und seine Grenzen: private und berufliche Altersvorsorge in der Schweiz im 20. Jahrhundert, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 48, 29–47; HLS / DHS / DSS: Pensionskassen.
(12/2014)
Seit den 1960er-Jahren standen die Bemühungen, das Krankenversicherungsgesetz (KVG) zu revidieren, vor einem schwer lösbaren Problem. Die Leistungen der Krankenversicherung galten unter linken und Mitte-Parteien als unzureichend. Andererseits kritisierten die bürgerlichen Parteien die ungebremste Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Das Schlagwort der „Kostenexplosion“ war bald in aller Munde.
Nach der gescheiterten Totalrevision von 1974 sahen sich die Bundesbehörden zum Handeln gezwungen. Als Reaktion auf den Kostenanstieg fror der Bund 1977 das Subventionsniveau auf dem momentanen Stand ein. Parallel dazu setzten Bundesrat und Parlament auf ein „Sofortprogramm“, um den steigenden Kosten und Defiziten zu begegnen. Das Programm beschränkte sich auf eine Teilrevision des KVG und schloss Grundsatzreformen wie die Einführung der allgemeinen Versicherungspflicht, neuer Finanzierungsmethoden oder substanzieller Leistungsverbesserungen aus. Man wollte um jeden Preis ein erneutes Scheitern der Vorlage verhindern.
1987 beschloss das Parlament ein entsprechend revidiertes KVG. Es sah auf der einen Seite die Erhöhung der Eigenbeteiligung der Versicherten vor. Diese sollten eine Jahresfranchise und einen verdoppelten Selbstbehalt (20 Prozent) entrichten. Auf der anderen Seite sollte der Kostenanstieg mit Kontrollmassnahmen im Behandlungsbereich und mit Auflagen im Tarifwesen und bei den Bundessubventionen bekämpft werden. Die Vorlage umfasste auch einen moderaten Leistungsausbau. Kosten für Spitalaufenthalte sollten vollumfänglich in die Krankenversicherung aufgenommen und die Hauskrankenpflege ausgebaut werden. Auf die Einführung einer obligatorischen Krankengeldversicherung wurde hingegen verzichtet.
Zum Stolperstein entwickelte sich ein Nebenaspekt der Vorlage von 1987. Die Behörden verknüpften die Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes mit einer Änderung der Erwerbsersatzordnung, um den bestehenden Verfassungsauftrag für eine Mutterschaftsversicherung endlich umzusetzen. Die Vorlage gewährte Frauen ein Mutterschaftstaggeld für die Dauer von 16 Wochen. Die Kosten sollten mittels Lohnprozenten hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. Der Gewerbe- und der Arbeitgeberverband lehnten diese Mutterschaftsversicherung ab und ergriffen das Referendum dagegen.
Am 6. Dezember 1987 lehnte das Stimmvolk die Teilrevision des KVG mit 71,3 Prozent Nein-Stimmen deutlich ab. Die Krankenversicherung verharrte gesetzlich weiter auf dem Stand von 1964.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Bernardi-Schenkluhn Brigitte (1992), Das Gesundheitssystem der Schweiz. Akteure, Strukturen, Prozesse und Reformstrategien, in Schriftenreihe der SGGP, 24, 1-191; Uhlmann Björn, Braun Dietmar (2011), Die schweizerische Krankenversicherungspolitik zwischen Veränderung und Stillstand. Zürich; Schuler Thomas, Frei Andreas (1987), Die Teilrevision der Krankenversicherung, Aarau.
(12/2015)
Die 1990er-Jahre bedeuteten für die Soziale Sicherheit eine turbulente Zeit. Das Ende des Kalten Kriegs führte dazu, dass der Grundkonsens zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, der die schweizerische Politik seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt hatte, zunehmend brüchig wurde. Die Folge war eine Polarisierung der politischen Kräfte. Verschärft wurden die Gegensätze durch eine Rezession, die zwischen 1991 und 1995 zu Wachstumseinbrüchen und Beschäftigungsrückgängen führte. Davon betroffen war insbesondere das Feld der Sozialen Sicherheit, das seit jeher politisch umkämpft war.
Die Krise hatte einerseits unmittelbare Auswirkungen auf die Sozialwerke; insbesondere die Arbeitslosen- und die Invalidenversicherung schrieben rote Zahlen. Andererseits gerieten die Sozialwerke von Seiten der Wirtschaft und der bürgerlichen Parteien zusehends unter Druck. Deregulierung lautete das zentrale Postulat. Mit dem Argument des demografischen Wandels stellten sie die langfristige Finanzierbarkeit der Sozialwerke in Frage und bekämpften die Erhöhung von Beitragssätzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht zu gefährden und die Profitmargen beizubehalten. 1994 verlangte etwa der Direktor des Arbeitgeberverbands, Peter Hasler, ein Moratorium beim weiteren Ausbau der Sozialwerke. Führende Exponenten der bürgerlichen Parteien legten nach und forderten eine Reduktion der Soziallasten. Einen Schritt weiter gingen die Wirtschaftsführer um den Präsidenten der Asea Brown Boveri, David de Pury, die 1995 mit einem "Weissbuch" an die Öffentlichkeit traten. Sie verlangten einen Umbau der staatlichen Vorsorge, die nur mehr eine minimale, durch Bedürfnisklauseln beschränkte Existenzsicherung garantieren sollte. Die Debatten drehten sich jedoch nicht nur um die Finanzierbarkeit der Sozialwerke. Rechtskonservative Kreise kritisierten seit den 1990er Jahren wiederholt den angeblich verbreiteten «missbräuchlichen Bezug» von Sozialleistungen.
Die Linke und die Gewerkschaften, aber auch Teile der politischen Mitte erblickten darin eine offene Provokation. Sie warnten vor der zunehmenden Entsolidarisierung und setzten auf die Erschliessung neuer Finanzquellen. 1994 sah sich Bundesrätin Ruth Dreifuss sogar bemüssigt, in einem offenen Brief an die Bevölkerung Spekulationen entgegenzutreten, wonach die AHV kurz vor dem Kollaps stehe. Zu Testfällen für eine deregulierte Sozialpolitik, die auf einen ausgewogenen Interessensausgleich verzichtete, gerieten schliesslich die Volksabstimmungen über das revidierte Arbeitsgesetz (1996) und über den dringlichen Bundesbeschluss zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung (1997). Die Stimmberechtigten waren in diesen Fällen nicht bereit, Leistungseinbussen hinzunehmen: Alle Vorlagen wurden an der Urne verworfen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Obinger Herbert, Armingeon Klaus et al. (2005), Switzerland. The marriage of direct democracy and federalism, in H. Obinger, S. Leibfried et al. (ed.), Federalism and the welfare state: New World and European experiences, 263–306; Année politique Suisse / Schweizerische Politik, 1990–1999; HLS / DHS / DSS: Marktregulierung.
(01/2020)
Am 4. Dezember 1994 nahmen die Stimmberechtigten das vollständig revidierte - und bis heute massgebende - Krankenversicherungsgesetz (KVG) an. Das neue Gesetz umfasst erstmals ein allgemeines Versicherungsobligatorium. Es ermöglicht den Wechsel der Kasse (Freizügigkeit), sieht gleiche Prämien für Frauen und Männer vor und beseitigt die Altersklassen. Der Leistungskatalog wurde leicht ausgebaut (beispielsweise in der Spitalpflege) und vereinheitlicht. Das seit 1911 geltende System der Kassensubventionierung wurde durch ein System der individuellen Prämienverbilligung abgelöst, von dem Einzelpersonen und Familien mit geringem Einkommen profitieren sollen. Nicht aufgenommen wurde dagegen eine obligatorische Krankentaggeldversicherung, die krankheitsbedingte Erwerbsausfälle absichert.
Die Totalrevision war ein komplexes und langwieriges Vorhaben. Nachdem 1987 eine Teilrevision gescheitert war, entschied sich der Bundesrat, eine grundlegende Reform in Angriff zu nehmen. Die Vorlage kam 1992 ins Parlament. Verkompliziert wurde die Reform durch die Vielzahl der involvierten Akteure (Parteien, Kantone, Krankenkassen, Ärzte, Spitäler, Pharmaindustrie), die unterschiedliche Interessen verfolgten. Eine Volksinitiative des Krankenkassenkonkordats forderte etwa die Erhöhung der Kassensubventionen, während eine Initiative der Sozialdemokratischen Partei für einkommensabhängige Prämien warb. Beide Initiativen wurden 1992 respektive 1994 abgelehnt. Gleichzeitig verschärfte sich der Reformdruck durch den - gemessen am Bruttoinlandprodukt - überproportionalen Anstieg der Kosten des Gesundheitswesens und der Krankenkassenprämien. Allein zwischen 1985 und 1990 stiegen die laufenden Gesundheitskosten pro Kopf um 42 Prozent. Im Schnitt hatten sich die Prämien zwischen 1965 und 1990 verzehnfacht; sie waren damit deutlich stärker als die Haushaltseinkommen gewachsen. Bereits zu Beginn der 1990er-Jahre ergriffen Bundesrat und Parlament deshalb Massnahmen zur Kostendämpfung und zur Stärkung der Solidarität zwischen den Versicherten. Das KVG sah einen zeitlich begrenzten Risikoausgleich zwischen den Kassen und Instrumente zur Förderung des Wettbewerbs und der Prävention sowie zur Kontrolle der Kosten vor (unter anderem mittels Preis- und Tarifkontrollen, Kostentransparenz und -beteiligung). Die weiterhin steigenden Kosten und Prämien führten in den letzten Jahren zu erneuten Reformvorstössen, die bislang jedoch allesamt scheiterten.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Obinger Herbert, Armingeon Klaus et al. (2005), Switzerland. The marriage of direct democracy and federalism, in H. Obinger, S. Leibfried et al. (ed.), Federalism and the welfare state: New World and European experiences, 263–306; Année politique Suisse / Schweizerische Politik, 1990–1994; HLS / DHS / DSS: Krankenversicherung.
(12/2014)
In den 1990er-Jahren begann das Schlagwort der Aktivierung die Debatten über die Soziale Sicherheit zu prägen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezeichnen die Aktivierung, inzwischen sogar als neues sozialpolitisches Paradigma. Die Idee der Aktivierung überträgt die Verantwortung für die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt den Personen, die sozialstaatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Die sozialen Sicherungssysteme sollen ihre Anstrengungen, aus eigener Kraft Arbeit zu finden, lediglich unterstützen und fördern. Die Selbst-Aktivierung bildet somit die Bedingung für staatliche Unterstützung. Dadurch liessen sich, so die Befürworter einer aktivierenden Sozialpolitik, Kosten sparen und die Effizienz der Wohlfahrtseinrichtungen optimieren. Kritikerinnen werfen dem Aktivierungsparadigma hingegen vor, blind gegenüber strukturellen Ursachen individueller Notlagen zu sein. Zudem diene die Rede von der Eigenverantwortung lediglich als Vorwand, um sozialstaatliche Leistungen abzubauen.
Zu Beginn der 1990er-Jahre stieg die Arbeitslosenquote in der Schweiz deutlich an. In diesem Umfeld bekam der Aktivierungsgedanke neue Bedeutung. Das revidierte Arbeitslosenversicherungsgesetz von 1995 erweiterte die arbeitsmarktlichen Massnahmen wie Kurse, Motivationsseminare oder Beschäftigungsprogramme. Die neu eingerichteten Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen sollten die Bemühungen der Versicherten unterstützen, eine neue Stelle zu finden. Gleichzeitig wurde die Zahl der Taggelder reduziert. Massnahmen zur beruflichen Eingliederung erhielten ebenfalls in der Sozialhilfe Auftrieb, wobei auch hier der Appell an die Eigenverantwortung mit neuen Sanktionsmöglichkeiten verbunden wurde. Bereits auf eine längere Tradition zurückblicken konnten solche Ansätze in der Invalidenversicherung. Um die – wachsende – Zahl der Neurenten und die Defizite des Sozialwerks zu verringern, stärkte die 5. IV-Revision (2006) das (altbekannte) Prinzip «Eingliederung vor Rente» zusätzlich. Massnahmen der Früherfassung und Frühintervention wie Case Management oder Coaching sowie spezifische Unterstützungsangebote sollten Menschen mit Behinderungen in die Lage versetzen, ihre Stelle zu behalten oder eine neue zu finden und ohne Rente zu leben.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Nadai Eva, Canonica Alan, Arbeitsmarktintegration als neu entstehendes Berufsfeld: Zur Formierung von professionellen Zuständigkeiten, Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 38, 23–37; Schallberger Peter, Wyer Bettina (2010), Praxis der Aktivierung. Eine Untersuchung von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, Konstanz; Magnin Chantal (2005), Beratung und Kontrolle : Widersprüche in der staatlichen Bearbeitung von Arbeitslosigkeit, Zürich; Année politique Suisse / Schweizerische Politik, 1995–2006; HLS / DHS / DSS: Invalidenversicherung IV; Arbeitslosenversicherung ALV.
(01/2020)
Trotz der missglückten Versuche von 1984 (Mutterschaftsinitiative) und 1987 (KVG-Teilreform), eine Mutterschaftsversicherung einzuführen, blieben der Verfassungsauftrag von 1945 und das Bedürfnis vieler Frauen nach materieller Sicherheit während der Mutterschaft aktuell. Der Frauenstreik von 1991, der die Umsetzung des Gleichstellungsartikels forderte, lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf die Mutterschaftsversicherung. Mit der Wahl der Sozialdemokratin Ruth Dreifuss in den Bundesrat erhielt das Projekt eine Verfechterin an höchster Stelle. Die Ausarbeitung der neuen Vorlage war von Frauenorganisationen und von den Frauengruppen der nationalen Parteien geprägt, die zeitweise am gleichen Strick zogen.
Das vom Parlament verabschiedete Gesetz von 1998 sah eine Mutterschaftsentschädigung über 14 Wochen für erwerbstätige Mütter und eine einmalige Grundleistung vor, die allen erwerbs- und nicht-erwerbstätigen Müttern zustand. Die Kosten der Versicherung sollten über Mehrwertsteuerprozente finanziert werden.
Wie bereits 1987 unterstützten die rechtsbürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände das Referendum gegen das Mutterschaftsversicherungsgesetz. Ihre Argumente stellten vor allem die Finanzierbarkeit der neuen Sozialversicherung in Frage. Der Bundeshaushalt, der um 1996 ein Defizit von 6 Milliarden aufwies, dürfe nicht noch stärker belastet werden. Weiter kritisierten die Gegner, dass auch die Finanzierung der anderen Sozialversicherungen nicht nachhaltig gesichert sei. Anstatt neue Sozialwerke zu schaffen, müssten zuerst die bestehenden gesichert werden.
Am 13. Juni 1999 sprach sich die Stimmbevölkerung mit 61 Prozent gegen die Einführung der Mutterschaftsversicherung aus. Die Abstimmungsanalyse offenbarte eine Ablehnungsrate von 70 Prozent in der Deutschschweiz gegenüber einer Zustimmungsrate von 78 Prozent in der Romandie. Der starken Mobilisierung der Frauen in der Westschweiz stand eine ebenso starke Mobilisierung der rechtsbürgerlichen Kräfte in der Deutschschweiz gegenüber.
Das unterschiedliche Wahlverhalten offenbarte, dass die Landesteile gegenüber dem Ausbau sozialstaatlicher Einrichtungen unterschiedlich eingestellt waren. Als Reaktion auf die Ablehnung der Mutterschaftsversicherung führte Genf bereits um 2001 eine eigene, kantonale Mutterschaftsversicherung ein. Erst um 2004 sollte die Einführung einer landesweiten Mutterschaftsversicherung gelingen.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Eidgenössisches Departement des Innern und Bundesamt für Sozialversicherungen (1999), Eidgenössische Volksabstimmung vom 13. Juni 1999. Dokumentation für die Mutterschaftsversicherung, Bern; Despland Béatrice, Fragnière Jean-Pierre (ed.)(1999), Politiques familiales l’impasse? Lausanne; HLS / DHS / DSS: Mutterschaft.
(12/2015)
Mit der Volksabstimmung vom 26. September 2004 kam keine Mutterschaftsversicherung zustande, die Leistungen für alle Mütter vorsieht, sondern eine Lösung, die sich auf den Erwerbsersatz beschränkt. Bereits in den 1920er-Jahren hatte die Mutterschaftsversicherung zur Debatte gestanden. Die Verfassungsgrundlage war 1945 geschaffen worden. Seither waren mehrere Anläufe zur Realisierung auf Gesetzesstufe - sei es im Rahmen der Krankenversicherung (1987) oder auf dem Weg der Volksinitiative (1984) - gescheitert.
Ein Vorstoss für eine Lösung, die über Mehrwertsteuerprozente finanziert worden wäre, kam 1999 durch ein Referendum zu Fall. Die Vorlage sah eine Mutterschaftsentschädigung über 14 Wochen für erwerbstätige Mütter und eine einmalige Grundleistung vor, die allen erwerbs- und nichterwerbstätigen Müttern zugestanden wäre. Rechtsbürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände, die die Finanzierbarkeit in Frage stellten, ergriffen erfolgreich das Referendum. Die Reaktionen auf die Abstimmung zeigten allerdings, dass das Anliegen inzwischen breit abgestützt war. Der Kanton Genf führte 2001 sogar eine kantonale Mutterschaftsversicherung ein.
Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesratsparteien setzten sich deshalb für einen Kompromiss auf Bundesebene ein, der sich trotz einem erneuten Referendum von Seiten der Schweizerischen Volkspartei (SVP) im September 2004 als mehrheitsfähig erwies. Viele Stimmberechtigte, die die Vorlage von 1999 noch abgelehnt hatten, stimmten nun zu. Die Mutterschaftsentschädigung wurde als Teil der Erwerbsersatzordnung (EO) eingerichtet, für die erwerbstätige Frauen seit 1940 Beiträge entrichtet hatten. Wie die EO wurde sie ausschliesslich über Lohnabzüge finanziert. Sie garantierte während 14 Wochen 80 Prozent des letzten Einkommens. Im Gegensatz zu früheren Vorlagen konnten jedoch nur Frauen Leistungen beziehen, die vor der Geburt erwerbstätig waren. Die Mutterschaftsversicherung trat im Jahr 2005 in Kraft.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Année politique Suisse / Schweizerische Politik, 1990–1994; Studer Brigitte (1997), Familienzulagen statt Mutterschaftsversicherung? Die Zuschreibung der Geschlechterkompetenzen im sich formierenden Schweizer Sozialstaat, 1920–1945, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 47, 151–170; Hauser, Karin (2004), Die Anfänge der Mutterschaftsversicherung. Deutschland und Schweiz im Vergleich, Zürich; Studer Brigitte, Sutter Gaby (2001), Die ‚schutzbedürftige Frau‘. Zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung, Zürich; HLS / DHS / DSS: Mutterschaft.
(08/2025)
Am 24. März 2006 verabschiedete das Parlament ein Familienzulagengesetz. Seit dessen Inkrafttreten 2009 haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Nichterwerbstätige mit Kindern Anspruch auf eine Familienzulage. Ebenfalls wurden die Mindestansätze der bestehenden Zulagen vereinheitlicht. Seit 2013 gehören auch Selbständige zu den Bezugsberechtigten, so dass nun der Grundsatz "ein Kind - eine Zulage" erfüllt ist. Die Familienzulage beträgt pro Kind bis zum 20. Altersjahr monatlich mindestens 200 Franken respektive 250 Franken, wenn sich das Kind in Ausbildung befindet. Organisatorisch greift das Familienzulagengesetz auf die bestehenden Familienausgleichskassen zurück. Die Finanzierung erfolgt durch die Kantone, die dazu Arbeitgeberbeiträge erheben können.
Das Familienzulagengesetz beruht - wie die ebenfalls erst 2004 eingeführte Mutterschaftsversicherung - auf einer Bestimmung, die bereits 1945 Eingang in die Bundesverfassung fand. In der Folge kam es jedoch nur in der Landwirtschaft zu einer bundesrechtlichen Regelung. Mit der Auszahlung von Familienzulagen an landwirtschaftliche Angestellte und Bergbauern hoffte man 1952 die Landflucht verringern zu können. Bis zur Jahrtausendwende führten jedoch alle Kantone Familienzulagen ein, die 2004 im Durchschnitt 184 Franken pro Kind betrugen. 2004 bestanden 115 öffentliche oder private Familienausgleichskassen. Auf Bundesebene gab es seit Beginn der 1990er-Jahre Pläne zu einer Harmonisierung der kantonalen Zulagen. Auftrieb erhielten diese aber erst durch die Volksinitiative für faire Kinderzulagen, die 2003 von der Gewerkschaft Travail.Suisse lanciert wurde. Sie sah eine deutliche Erhöhung der Zulagen auf 450 Franken vor, wurde jedoch nach dem Vorliegen eines Gegenvorschlags zurückgezogen.
Die Initiative wie das spätere Familienzulagengesetz fielen in eine Zeit verstärkten familienpolitischen Aktivismus. Die Familie wurde zunehmend als Armutsrisiko erkannt. Viele Kantone begannen deshalb, Familien mit geringem Einkommen finanziell zu unterstützen. Der Bund lancierte seinerseits 2003 ein Impulsprogramm für den Ausbau der Tagesbetreuung. Seit 2000 liefen zudem Diskussionen um eine Erweiterung der Ergänzungsleistungen auf Familien – ein Modell, das erst wenige Kantone kannten.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Année politique Suisse / Schweizerische Politik, 2000–2006; Parlamentarische Initiative Leistungen für die Familie. Zusatzbericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, 8. September 2004, Bundesblatt, 2004, 6887–6926; HLS / DHS / DSS: Familienzulagen.
(01/2020)
Die Entwicklung der Sozialen Sicherheit seit Beginn der 1990er-Jahre ist vielschichtig und konfliktreich. Im Vergleich zu den vorangehenden zwanzig Jahren flachte der Anstieg der Soziallastquote (Quotient aus Sozialversicherungseinnahmen und Bruttoinlandprodukt) merklich ab. Vor dem Hintergrund einer wechselhaften Konjunkturlage entwickelte sich die Sozialpolitik zu einem hart umkämpften Politikfeld, das von instabilen politischen Allianzen bestimmt wurde. Symptomatisch dafür ist die Entwicklung der Zahl der Volksabstimmungen, die sozialpolitische Fragen betrafen. Machten sie zwischen 1971 und 1990 rund 18 Prozent aller Vorlagen aus, so stieg ihr Anteil von 1991 bis 2017 auf 31 Prozent an. Offenbar gelang es den politischen Kräften immer seltener, gegensätzliche Interessen einzubinden und mehrheitsfähige Kompromisse zu finden.
Insbesondere bei der Krankenversicherung und der Altersvorsorge führten die unterschiedlichen Problemwahrnehmungen der Linken und der Bürgerlichen zunehmend zu einer Pattsituation. Bei der Einführung des Obligatoriums der Krankenversicherung (1994) gelang es noch, eine Mehrheit für einen moderaten Ausbau zu finden. Die steigenden Gesundheitskosten führten seither zu zahlreichen Reformprojekten. Viele davon scheiterten im Parlament oder an der Urne. Als Instrument der Kostendämpfung setzte die Linke auf eine öffentliche Einheitskasse. Die Stimmbevölkerung lehnte jedoch entsprechende Volksinitiativen 2007 und 2014 ab. Ebenfalls an der Urne abgelehnt wurde 2012 die zweite Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes. Ausschlaggebend war die Sorge vor dem Verlust der freien Arztwahl. Erfolgreicher waren kleinere Schritte wie die Einführung des Risikoausgleichs zwischen Krankenkassen sowie die Vereinheitlichung von Arzttarifen. Die steigende Lebenserwartung und die Zunahme an Alterskrankheiten führten im Gesundheitsbereich zu Diskussionen um die Finanzierung des wachsenden Pflegebedarfs.
Nach der letzten umfassenden Reform der Altersvorsorge 1996 (10. AHV-Revision) setzte eine Diskussion um weitergehende Reformen ein. Während bürgerliche Parteien im Namen des demografischen Wandels auf eine Erhöhung des Rentenalters zielten, warnten die Linken vor einer Entsolidarisierung und setzten auf neue Finanzierungsquellen. Vorlagen für eine 11. AHV-Reform scheiterten jedoch 2004 an der Urne und 2010 im Parlament. Deutlich verwarf das Stimmvolk 2010 auch die Senkung der Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge. Das Reformpaket „Altersvorsorge 2020“ setzte auf die gleichzeitige Reform von AHV und Beruflicher Vorsorge und scheiterte 2017 ebenfalls in der Abstimmung, Hauptkritikpunkt war die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre. Erst 2019 akzeptierte das Stimmvolk im Rahmen einer Steuerreform einen Vorschlag, der zu Mehreinnahmen in der AHV führte. Um die verbleibende Finanzierungslücke zu decken und die strukturellen Probleme der AHV zu lösen, erarbeitete der Bundesrat einen neuen Vorschlag. Die «AHV 21» sah eine Erhöhung des Frauenrentenalters mit Ausgleichsmassnahmen, eine Flexibilisierung des Rentenalters sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor. Die Reform der Altersvorsorge blieb damit eine der wichtigsten Baustellen der Sozialen Sicherheit, zumal für die Berufliche Vorsorge erst Reformansätze der Sozialpartner vorlagen.
Seit den 1990er Jahren rückte die soziale Absicherung bei einer Mutter- und Vaterschaft zunehmend in den Vordergrund. In diesem Bereich wurden die Sicherungsinstrumente stark ausgebaut. So gelang es, eine Mehrheit für die Mutterschaftsversicherung (2004) und die Harmonisierung der Familienzulagen (2006) zu finden. Ebenfalls investierten Bund und Kantone in Betreuungsstrukturen für Kleinkinder, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erhöhen. Dennoch hinkt die Schweiz in diesem Bereich nach wie vor anderen OECD-Ländern hinterher.
Seit Ende des 20. Jahrhunderts werden zudem grundsätzliche Fragen über die Zukunft der Sozialen Sicherheit diskutiert. Die "neue Armut" wurde zum Thema. Von ihr betroffen sind insbesondere alleinerziehende Frauen, ausgesteuerte Arbeitslose oder Familien mit geringem Einkommen. Die Arbeitslosenversicherung (1995) und die Sozialhilfe setzten als Reaktion auf eine rasche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Die sogenannte Aktivierungspolitik blieb jedoch umstritten. Kritikerinnen und Kritiker sahen in den Massnahmen einen verdeckten Leistungsabbau sowie eine verstärkte Kontrolle der Leistungsbeziehenden. Diskutiert werden zudem neue Modelle der sozialen Sicherung, um dem Wandel der Arbeitsverhältnisse (Teilzeitarbeit) und neuen familiären Lebensformen (Ein-Eltern- oder Patchwork-Familien) gerecht zu werden. Zu den vorgeschlagenen neuen Instrumenten gehören etwa die allgemeine Erwerbsversicherung oder das bedingungslose Grundeinkommen, dessen Einführung allerdings 2016 an der Urne klar abgelehnt wurde.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Studer Brigitte (2012), Ökonomien der sozialen Sicherheit, in P. Halbeisen, M. Müller, B. Veyrasset (ed.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 923–974, Basel; Obinger Herbert, Armingeon Klaus et al. (2005), Switzerland. The marriage of direct democracy and federalism, in H. Obinger, S. Leibfried et al. (ed.), Federalism and the welfare state: New World and European experiences, 263–306, New York; Année politique Suisse / Schweizerische Politik, 1990–2010.
(01/2020)
Mit dem Button können Sie zwischen den verschiedenen Jahren wechseln.